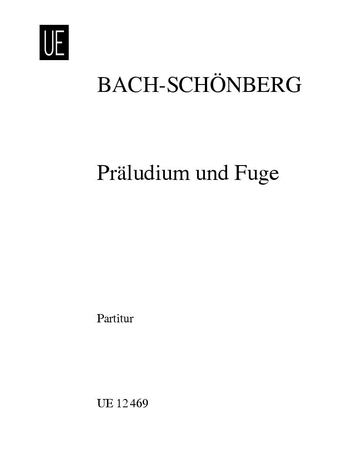.png)
Bezahlung:
Lieferung:
Johann Sebastian Bach
Bach: Präludium und Fuge Es-Dur für Orchester - BWV 552, für Orchester
Bearbeitet von: Arnold Schönberg
UE12469
Ausgabeinfo: gesetzt für grosses Orchester von Arnold Schönberg
Ausgabeart: Studienpartitur
Format: 232 x 305 mm
ISBN: 9783702411688
Seiten: 80
ISMN: 979-0-008-01954-8
Bezahlung:
Lieferung:
Hörbeispiel
Beschreibung
Jeder, der einmal unterrichtet hat, kennt die Schwierigkeiten, die die erschöpfende Analyse eines Werkes bereitet. Soll sie gut sein, so kann es natürlich nicht bei angewandter Formenlehre bleiben, sondern der Lehrer darf die Komposition, nur zergliedern, um sie nachher, und das ist die Hauptarbeit, nachschöpferisch wieder zusammenzusetzen. Er muss das Werk sozusagen vor dem Schüler neu komponieren. Denn nur wenn dieser nicht allein die Bestandteile erkennen lernt, sondern auch sieht, wie aus diesen das Ganze entstanden ist, wird er es verstehen können. Auf diesem hohen. Niveau berühren sich auch Interpretation und Unterricht — der Lehrer wird zum Interpreten, der Interpret (wer verlangt anderes von ihm?) zum Lehrer. In diesem Sinne nun ist Schönbergs Instrumentation eine großartige Analyse, geschrieben für großes Orchester (das gleiche wie für die vor angegangenen Choralinstrumentierungen), der die Erklärung aller Belange – Harmonie, Kontrapunkt, Form – vollendet gelungen ist.
Zur Ausdeutung der melodischen Vorgänge dient vornehmlich eine genaue, ganz in Bachischem Sinne gehaltene Phrasierung. So vieldeutig aber die Konstruktion eines Bach-Themas ist, so vielgestaltig und auf beinahe immer andere Art wird es von Schönberg phrasiert. Das geschieht natürlich nicht willkürlich, sondern hängt stets von der formalen Stellung des Themas, von der Eigenart des Instrumentes und von der Lage ab. Um ein Beispiel aus vielen herauszugreifen: Zu Beginn des dritten Abschnittes der Fuge erscheint der Dux, zuerst ganz ohne Vortragsbezeichnungen, in den Posaunen. In dem von der Trompete gebrachten Comes sind bereits die vierte und fünfte Note durch einen Bogen verbunden, die drei nachfolgenden mit Stakkatopunkten versehen. Die dadurch entstehende Gliederung betont auf das entschiedenste den Schwerpunkt der Melodie und zeigt, dass die drei ersten Noten als Auftakt zu verstehen sind. Weiters verrät diese Phrasierung, im nachfolgenden eintaktigen Zwischenspiel beibehalten, dessen thematische Herkunft. Der in den Hörnern von neuem einsetzende Dux bleibt wieder unbezeichnet, wodurch die Beziehung zum Anfang hergestellt wird, nämlich: nochmals die Tonikaform – nochmals der gleiche Vortrag. Der Comes kehrt jetzt in den Klarinetten und Oboen in veränderter, dem Charakter der Instrumente und der nun hohen Lage angepasster Phrasierung (mehr legato) wieder, die aber gleichzeitig eine Variation der früheren Vortragsbezeichnung darstellt.
Eine andere Art der Verdeutlichung melodischer Konstruktion ist die von Hans v. Redlich sehr treffend so bezeichnete instrumentale Dividierung (siehe dessen Aufsatz „Zu Schönbergs Instrumentierung zweier Bachscher Choralvorspiele“ im Marz-Aprilheft 1927 von Pult und Taktstock). Sie besteht in der Aufteilung einzelner Themenbestandteile auf zwei verschiedene Instrumente und wird vom Schönberg häufig dort angewendet, wo eine melodische Linie von Bach wohl einstimmig geführt wird, als Folge seiner eminent kontrapunktischen Erfindung aber im Grunde genommen latent zweistimmig verläuft.
Überhaupt sind in dieser Partitur alle verborgenen Beziehungen aufgedeckt. Lange bevor das Fugenthema ein tritt, wird dessen Vorbereitung im Präludium durch entsprechend aufgesetzte Akzente und unterstreichende Phrasierung aufgehellt. Dann wieder zeigt uns die Instrumentierung, dass die Verbindung der melodischen Wendepunkte zweier Stimmen zu einer dritten, das von Bach geradezu absichtlich verborgene Hauptthema ergibt.
Das klangliche Vorbild dieser Instrumentation, von deren speziellen Eigenschaften einige zu charakterisieren versucht wurden, ist die Registrierung einer Orgel. Nur sind hier im Orchester alle Schwerfälligkeit und Unzulänglichkeit dieses Instrumentes abgestreift und in Belebtheit verwandelt, alle Grenzen viel weiter gesteckt. So reichhaltig, differenziert und wirkungsvoll diese Partitur aber auch ist, es kommt kein einziger ,,Effekt“ vor, der nicht zweckmäßig und sinnvoll wäre, nicht innere musikalische Berechtigung hätte. Am hervorragendsten zeigt sich das in der Fuge, wo die Instrumentation in steter Bereicherung aufs genaueste mit der thematischen Entwicklung Schritt hält. Hier erzielt Schönberg unter Anwendung aller Mittel, bekannter und bisher nie versuchter, eine überwältigende orchestrale Steigerung, die in der ganzen Literatur ihresgleichen sucht. Die formale Dreiteilung der Fuge hervorhebend, wird der erste Abschnitt beinahe ausschließlich von den Holzbläsern (die Themenaufstellung sogar fast nur von den Klarinetten), der zweite anfänglich nur von den Streichern, der dritte zu Beginn nur von den Blechbläsern gespielt. Der erste Teil lässt sich als eine Imitierung des Orgelklanges auffassen. Durch die Beibehaltung ähnlicher Farben ergibt sich ein einfaches Klangbild, das die Exposition in keiner Weise belastet. Im Gegensatz zu einer vielfach üblichen Vortragsweise, die immer (ganz gegen den Sinn des absoluten Kontrapunktes als der vollen Gleichberechtigung aller Stimmen) das jeweils neu einsetzende Thema vor den übrigen dynamisch besonders hervorhebt, basiert hier die deutliche Unterscheidung der Stimmen voneinander nur auf einer wohldurchdachten Phrasierung. Gleichzeitig Erklingendes ist ungleichartig bezeichnet, legato steht gegen staccato, Bögen, überschneiden einander. Die Wirkung des letzten Themaeinsatzes wird dadurch gehoben, dass ihn die Tuba als einziges Blechblasinstrument bringt. Im anschließenden zweiten Abschnitt übernehmen die Streicher die Themenaufstellung. Dann treten bereits Blasinstrumente hinzu. Anfänglich im Unisono mit den Streichinstrumenten, deren Phrasierung unterstützend und wichtige Punkte hervorhebend, übernehmen sie später auch das Thema, so die instrumentale Unterscheidung als weitere Steigerungsstufe nach der Phrasierung einführend. Eine geniale Betonungsbezeichnung, zweimal auftretend, zeigt die Entstehung des dritten Fugenthemas, das sich in den Blechbläsern anschließt. Hier werden nun bald alle geschilderten Mittel gemeinsam angewendet. Prägnanteste Phrasierung, schärfste klangliche Unterscheidung, Einführung der Themen durch immer gewichtigere, stärkere
Instrumentalgruppen überbieten einander zu einer grandiosen Steigerung. Und gegen Schluss, wo alle verfügbaren Mittel schon erschöpft zu sein scheinen, verwirklicht Schönberg eine unerhört kühne Idee. Er verdoppelt das Thema, seine Stärke, nicht seine Lautheit vervielfachend, nach dem Muster der Orgelmixtur, in den ersten drei Obertönen. Und zwar in zwei Formen, von denen die eine die andere noch übersteigert. Zuerst erscheinen über der Hauptstimme die Oktaven-, Quinten- und Terzengänge nur in den leitereigenen Tönen, dann aber läuft die Verdoppelung zum Es-Dur-Thema in B-Dur und G-Dur mit. Dass diese von Harfe und Celesta besorgt wird, bedeutet überdies die bisher nicht gelungene Lösung eines alten Problems. Während diese Instrumente früher im Tuttiforte, hier nicht anders gesetzt als sonst, wirkungslos untergingen, beeinflussen sie nun zum ersten Mal, trotz ihrer Lautschwäche, den Gesamtklang. Ja, sie dürften, zur Erfüllung dieser Aufgabe gar keinen anderen Klangcharakter besitzen. So aber kommt das Wesen ihres Klanges einer charakteristischen, Eigenschaft der Obertöne entgegen. Wenn sie nämlich diese, die Plastik der Grundtöne hebend, verstärken, wird ihre Not: zu erklingen, quasi ohne gehört zu werden, zur Tugend.
Felix Greissle in Pult und Taktstock, VI Jahrgang 1929, Heft 4
Mehr Informationen
Ausgabeinfo: gesetzt für grosses Orchester von Arnold Schönberg
Ausgabeart: Studienpartitur
Format: 232 x 305 mm
ISBN: 9783702411688
Seiten: 80
ISMN: 979-0-008-01954-8