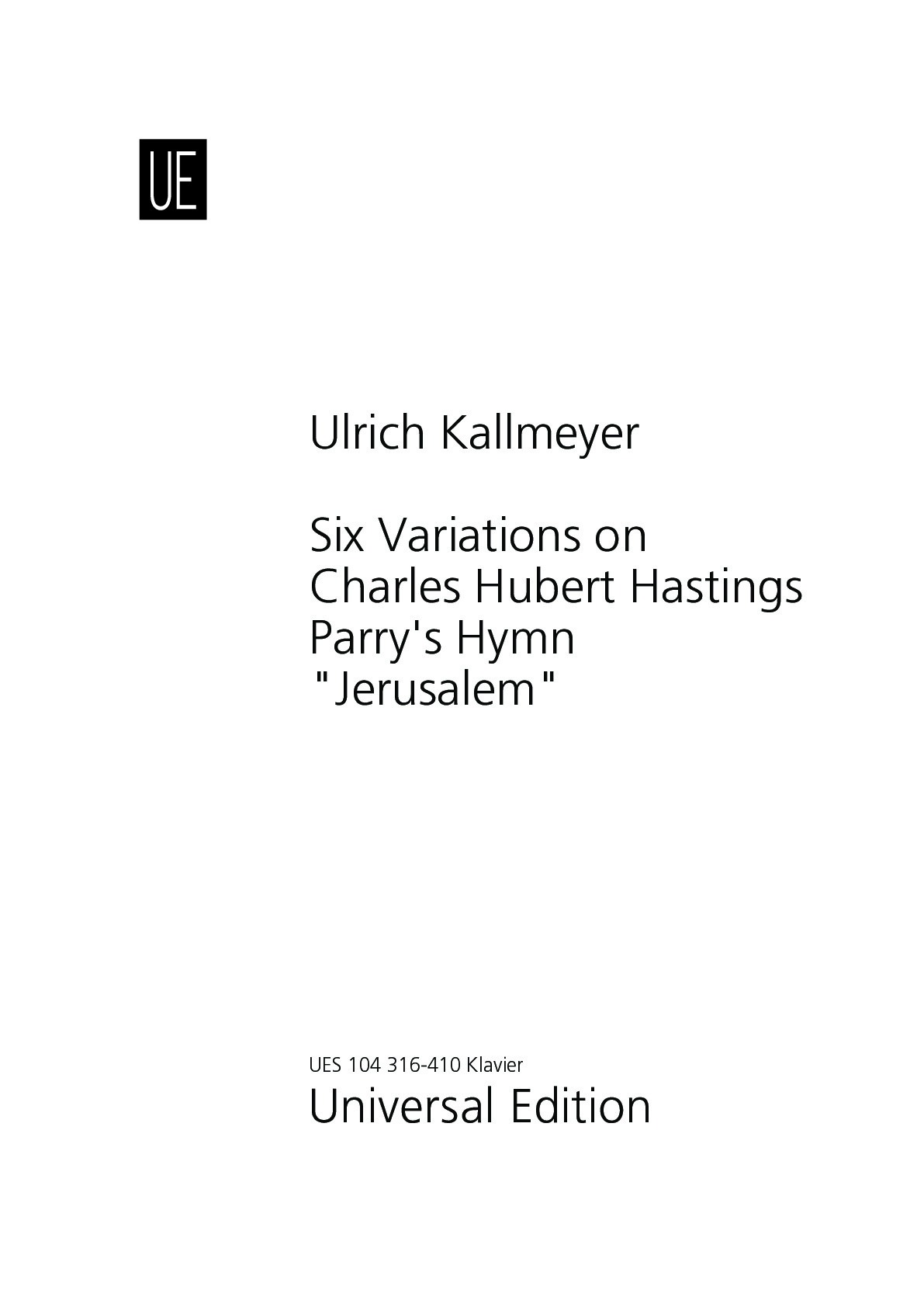.png)
Digitale Kaufausgabe
Sofort verfügbar als PDF
14,95 €
Bezahlung:
Lieferung:
Ulrich Kallmeyer
Sechs Variationen über Charles Hubert Hastings Parrys Hymne "Jerusalem"
UESD104316-410
Ausgabeart: digitale Noten
Format: 210 x 297 mm
Seiten: 12
Digitale Kaufausgabe
Sofort verfügbar als PDF
14,95 €
Bezahlung:
Lieferung:
Hörbeispiel
Beschreibung
Einspielung des Werkes auf der CD "Kosmos und Fragment"
Beethoven Webern Kallmeyer
Marie Rosa Günter
- Release Date: 5th May 2023
- Catalogue No: GEN23833
- Label: Genuin
- Length: 76 minutes
Dass Beethoven niemals einen Fuß auf englischen Boden setzte, wissen wir mit Sicherheit. Für Jesus Christus ist das, angesichts der zeitlichen Entfernung und der mangelhaften Quellenlage, insbesondere seine Jugend betreffend, nicht mit Bestimmtheit zu sagen, das Gegenteil freilich ebensowenig. In dem Gedicht "Jerusalem" nimmt William Blake (1757 - 1827) eine alte Legende auf, nach der Jesus in Begleitung von Joseph von Arimathia das englische Glastonbury besucht haben soll:
Und sind in alter Zeit jene Füße
Auf Englands grünen Bergen gewandelt?
Und ward das heilige Lamm Gottes
Auf Englands lieblichen Weiden gesehen?
Und strahlte das göttliche Antlitz
Hervor auf unseren umwölkten Hügeln?
Und wurde Jerusalem hier erbaut
Inmitten dieser dunklen teuflischen Mühlen?
Bringt mir meinen Bogen aus brennendem Gold –
Bringt mir meine Pfeile der Sehnsucht –
Bringt mir meinen Speer: O ihr Wolken teilt euch!
Bringt mir meinen Streitwagen aus Feuer.
Ich werde weder vom geistigen Kampf lassen
Noch soll das Schwert in meiner Hand ruhen,
Bis wir Jerusalem errichtet haben
Auf Englands grünem und lieblichem Grund.
William Blake entwickelte während seines Lebens eine sehr persönliches, visionäres Verständnis von christlichem Leben in Freiheit und menschlicher Selbstbestimmung. Die Stadt Jerusalem erscheint im Gedicht als Metapher für dieses soziale und politische Ideal, auf dessen Errichtung sich angesichts einer als problematisch empfundenen Gegenwart ("our clouded hills") Blakes Hoffnung richtete. "Dark satanic mills" mag sich auf eine in der Nachbarschaft von Blakes Londoner Wohnort damals tatsächlich existierende Mühle beziehen, die ihm das Leben der Arbeiterschaft unter frühindustriellen Produktionsmethoden vor Augen führte. Während also Beethoven aus der Ferne die englischen Verhältnisse mit verklärendem Blick wahrnahmi, sind im Land die sozialen Schattenseiten der ungeheuren Wirtschaftsentwicklung und des proportional gesteigerten nationalen Selbstbewusstseins längst bemerkbar. Winston Churchill brachte das in einem Wahlkampfslogan von 1901 mit grimmigem Witz auf den Punkt: "I see little glory in an Empire which can rule the waves and is unable to flush its sewers". (Ich sehe wenig Glanz in einem Weltreich, das zwar die Meere beherrschen kann, aber mit der Spülung seiner Abwasserkanäle überfordert ist". (Verdeutschung: U.K)
Tatsächlich war bereits auf der britischen Insel, vielleicht nicht in Blakes umfassenden Verständnis, aber doch mit für die Zeit beinahe unglaublicher Zugewandtheit und Menschlichkeit, wie ein Wunder eine Art Jerusalem entstanden: in dem kleinen schottischen Ort New Lanark am Fluss Clyde verwirklichte der Unternehmer Robert Owen (1771–1858) in den Jahren nach 1800 eine Baumwollfabrikation, bei der er die Sozialbedürfnisse seiner Arbeiterfamilien nach beinahe modernen Maßstäben berücksichtigte. In Anbetracht von "Jerusalem" als festem Programmbestandteil der "Last night of the Proms" sowie bei unzähligen ähnlichen mehr oder weniger staatstragenden Anlässen tritt allerdings dieses feine Moment der Selbstkritik in der Regel weniger hervor. Dabei hatte Parry selbst noch einen zusätzlichen politischen Akzent gesetzt, indem er der Nutzung von "Jerusalem" als Lied der britischen Suffragetten zur Duchsetzung des Frauenwahlrechts ausdrücklich zustimmte, und auch dessen Einführung 1928 erscheint als kleiner Schritt auf dem Weg nach Jerusalem, wie es Blake imaginiert haben mag.
Der eigentlichen Melodie hat Parry einen einleitenden Viertakter vorangestellt. Dieser wird im Verlauf der "Six Variations" konsequent mitgeführt und bildet jeweils zwischen zwei Variationen eine metrische und figurative Überleitung. Die Variationen ihrerseits sind Landschaftsstudien, Perspektiven auf Englands "green and pleasant land" in unterschiedlicher Farbigkeit und bei verschiedenen Wetterlagen, teils parodistisch, teils ironisch zu verstehen. Nach der sechsten Variation tritt die Reihe aus dem verrauchten Schatten heraus zurück ins helle Licht der Originalversion, die nun abschließend, von Männer- und Frauenstimmen im Oktavabstand, festlich gesungen wird.
Mehr Informationen
Ausgabeart: digitale Noten
Format: 210 x 297 mm
Seiten: 12