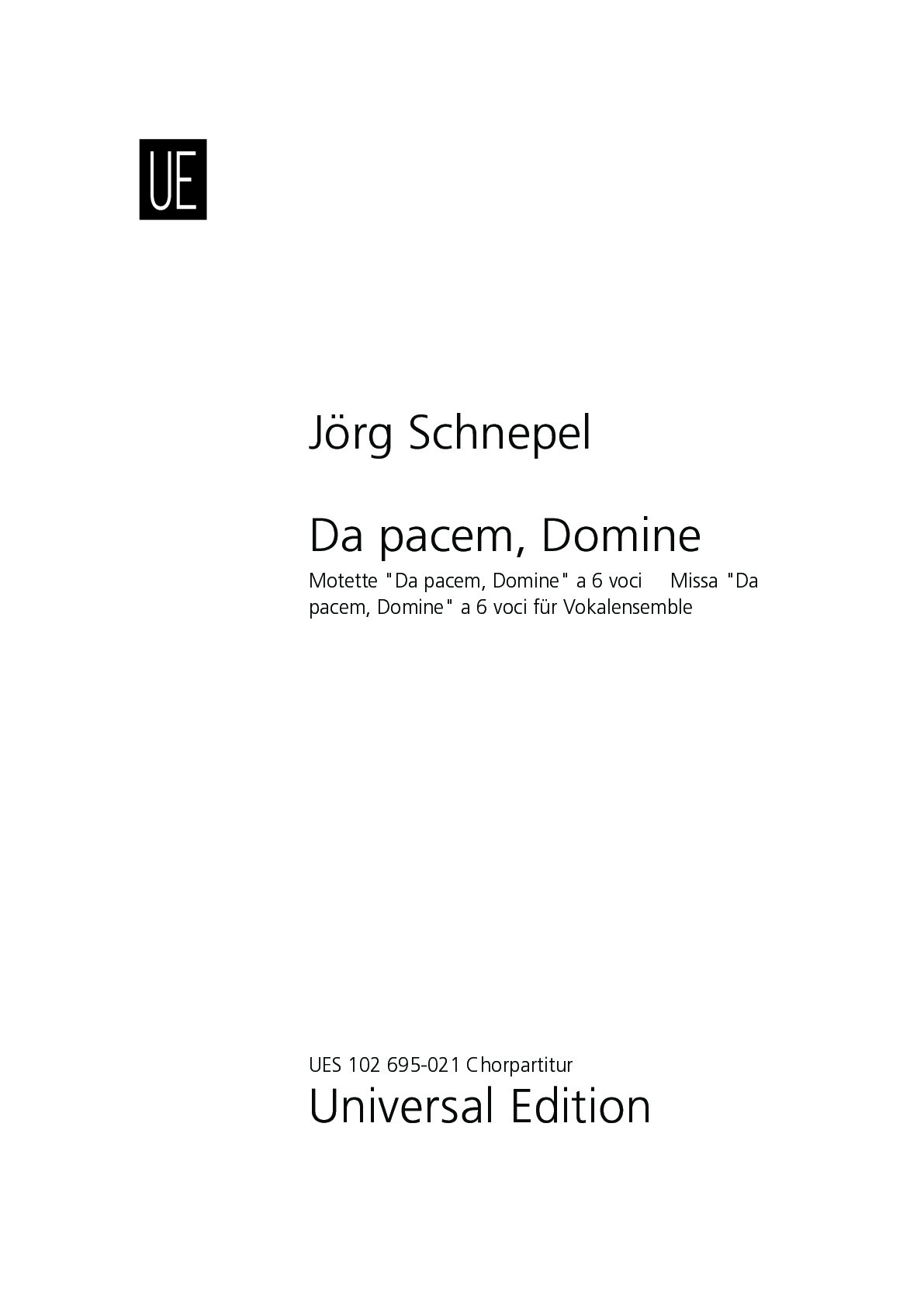.png)
Digitale Kaufausgabe
Sofort verfügbar als PDF
28,95 €
Bezahlung:
Lieferung:
Jörg Schnepel
Vokalensemble (Da pacem, Domine )
UES102695-021
Ausgabeart: Chorpartitur
Format: 210 x 297 mm
Seiten: 88
Digitale Kaufausgabe
Sofort verfügbar als PDF
28,95 €
Bezahlung:
Lieferung:
Hörbeispiel
Beschreibung
Werkkommentar
Im Mai 2020 hatte ich für das renommierte deutsche Vokalensemble "Singer Pur" eine kurze Motette geschrieben: zu sechs Stimmen über den bekannten Choraltext "Da pacem, Domine".
Ich erkannte sogleich das Potenzial in dieser Musik, das nach einer Fortsetzung drängte.
Es war naheliegend, diesen gewichtigen Worten der Bitte um "Frieden" eine entsprechende musikalische Form zu geben: und dies konnte nur eine Messe sein.
So entstand also in ca. 5 Wochen eine komplette Parodiemesse, wie wir sie aus der Blütezeit des 16. Jahrhunderts kennen. Statt eine Vorlage eines anderen Komponisten zu nehmen, verwendete ich eine eigene Vorlage in Form der genannten Motette. Dieses Verfahren war auch vor 500 Jahren schon bekannt.
Prinzipiell ist die vorliegende Messe klangästhetisch in zwei Teile gegliedert:
Der Beginn eines jeden Satzes verwendet als Grundlage den ersten Teil der Motette, bei den umfangreichen Textabschnitten auch die ganze Motette. Hinzukommend werden Abschnitte eingesetzt, die gar nichts mit der Motettenvorlage oder dem musikalischen Material des Chorals gemein haben.
Eine Ausnahme stellt lediglich das Christe eleison dar, indem in kurzen Fragmenten der Choral kanonisch von den tiefen zu den hohen Stimmen wandert.
Sind die materialgebundenen Messteile kompositionstechnisch und im Ausdruck sehr konzentrierte, einheitliche Kompositionen, die durchaus bewusst an die Ideale des 16. Jahrhunderts anknüpfen wollen, ohne eine blosse schablonenhafte Kopie einer alten, längst vergangenen Zeit zu sein, so erweisen sich gerade die freien Teile als besonders kreativ und variabel in der Zuspitzung des musikalischen Audruckes, der zuallererst wortgezeugt ist
Kyrie
Sofortiger Beginn der mannigfaltigen Sechsstimmigkeit in real sechs eigenständigen Linien ohne Verknüpfung durch Imitationen. Nach dem ersten Höhepunkt in Mensur 6 entwickelt die Musik ihr weiteres Voranschreiten durch genau jene Imitationstechnik, die vorher noch gänzlich fehlte. Nach gerade mal 14 Mensureinheiten endet dieser Satz in breit ausströmenden vokalen Linien.
Schon der zweite Satzabschnitt , welcher keinerlei Gemeinsamkeiten mit der Vorlage aufweist, das Christe eleison, ist mit 36 Mensuren fast dreimal so umfangreich als das Kyrie eleison I. Zwei wesentliche Unterschiede zwischen diesen beiden Sätzen sind schnell genannt:
- die melodische Gestaltung der Linie und
- deren Beziehung zu den übrigen Stimmen
Gerade die Vielfalt der Intervalle in der horizontalen und vertikalen Ebene und die rhythmische Organisation des Satzes bringen ein erhebliches Potential an Möglichkeiten mit sich, dass sich gerade hier das Schöpfertum des Komponisten ausbreiten kann. Es müssen nicht alle drei musikalischen Parameter - Melodie, Harmonik und Rhythmus gleichermaßen davon betroffen sein - später sehen wir auch Beispiele, wie die Rhythmik von der Neugestaltung herausgenommen werden kann - .
Das abschliessende Kyrie eleison II beendet dann den ersten Messsatz auf eine Art und Weise, dass beide Stile sich zu einem runden, sich ergänzendem Kunstwerk zusammenfinden.
Gloria
Der erste Teil des vorliegenden Glorias ist ein einziger "Jubilus". Bemerkenswert das konsequente Ausfüllen der Musik mit kleinen Notenwerten durch sämtliche Stimmen. Die "Engführung" der einzelnen Motive bekommt in seiner Bedeutung als konstruktivistisches Element eine besondere Qualität, die sich nicht vordergründig platzieren will, sondern im Sinne der Ausdruckssteigerung tiefgründig erlebbar wird.
Dann der "Stylo Nova": spätestens beim Qui tollis und der atonalen Chorfuge " Qui sedet ad dexteram Patris" mit dem alles überspannenden "Miserere nobis" im Superius dürfte einzusehen sein, dass bei einem sinnvollen Einsatz von gänzlich differierenden Stilmitteln - hier tonal gebunden, dort atonal offen - die Musik in Tiefenschichten des menschlichen Geistes und der Empfindung subtil einwirken kann, welche andernfalls kaum so nachvollziehbar sein dürfte. Nicht nur in kleinen formalen Abschnitten, sondern auch in weiträumigen "Dimensionen" ist der "Neue Stil" überzeugend, denn erst mit dem Cum Sancto Spiritu kehrt die Musik zur ursprünglichen Vorlage - der Motette - zurück.
Credo
Das Glaubensbekenntnis ist in neun Abschnitten gegliedert und damit von einem Umfang - die Aufführungsdauer liegt annähernd bei 15 Min. - das eine liturgische Einbindung des Credos wenig wahrscheinlich ist. Dias war aber von Anfang an keine zielgerichtete Option, sondern eine neuartige, in jeder Hinsicht intensive künstlerische Auseinandersetzung mit dem Ordinarium Missae.
Vergleichbar mit dem textreichen Gloria, sind die Abschnitte 1 und 9 basierend auf den Motettentext gestaltet. Der ganze Rest ist ohne Bindung an vorgegebenen Materialen, d.h. ein erheblicher Anteil des Credos ist völlig neu geschrieben. Darüberhinaus werden in dem ersten und letzten Teilen nur noch die drei tiefsten Stimmen mit dem Notentext der Motette ausgestattet, so dass diese Stimmen nur über wenig Durchsetzungskraft verfügen und die drei Oberstimmen wiederum mit neuem Material die Dominanz an sich ziehen.
Eine Bemerkung zu den teilweise sehr langsamen Metronomangaben wäre jetzt sinnvoll, denn das "Geheimnis der Menschwerdung Christi", also das Et incarnatus est , ist ein klanglicher Zustand und keine musikalische Entwicklung. Jedoch entscheidet stets der künstlerische Leiter bei einer Aufführung, ob die Vorgaben übernommen werden oder nicht. Allein die akustischen Bedingungen setzen unter Umständen andere Geschwindigkeiten für eine wirkungsvolle Darstellung der Komposition voraus.
Sanctus
Homophoner Beginn mit dreimaligen Ausruf: Sanctus, sanctus, sanctus!
Danach polyphoner Satz zu 3 Stimmen, kurz darauf zu 6 Stimmen mit rythmischen 2:3 Konflikt wegen dem simultanen Gebrauch der Taktarten 9/4 und 3/2.
Die Superius - Stimme in Manier eines Koloratur- Soprans sehr biegsam und virtuos.Darauf folgt ein Juwel der dreistimmigen Satzkunst: in acht Variationen und anschliessender Coda über ein Bassthema. Anders als die Tradition es erwarten ließe, werden dass Pleni sunt caeli et terra und das darauf folgende Hosanna in excelsis attacca vorgetragen. Damit kann die kleingliedrige Anlage vermieden werden und das darauf folgende Benedictus erhält einen angemessenen, kontemplativen Charakter.
Ebenso untypisch beschliesst das Hosanna in excelsis II nicht als "Da capo", sondern ganz im Sinne des Varietas-Prinzips als figurative Variation des Hosanna in excelsis I.
Agnus Dei
Mit dem Agnus Dei I wird dann zum ersten Mal die zentrale Tonart in A verlassen und die Herabsetzung der Tonart nach As verleiht der Musik eine
Dunkelheit bis hin zur Niedergeschlagenheit, die den Glanz eines Hosanna in excelsis schnell vergessen lässt. Es soll nicht unerwähnt bleiben, das dieser erste Agnus Dei - Satz Eingang fand als Sekunda pars der Lamentatio nova super morte Josquin des Prez (ca. 1450 - 1521), welches beim Festival "Laus Polyphoniae" in Antwerpen vom Huelgas Ensemble unter der Leitung von Paul Van Nevel am 500. Sterbetages Josquins, am 27. August 2021 die Uraufführung erlebte.
Mit Agnus Dei II wird das harmonische Geschehen auf ein Minimum reduziert. Die drei Bicinien sind durchweg linear konzipiert und man könnte
meinen, bei Sichtung des Notenbildes eine Komposition von Johannes Ockeghem vor sich zu haben. Was die Rhythmik anbelangt, muss man zustimmen (siehe Anmerkung in Abschnitt Kyrie, vorletzter Absatz), jedoch sind die melodischen Qualitäten völlig anders geartet: die Modulationsfähigkeit ist gegenüber den historischen Vorbildern erheblich erweitert und damit differenzierter im Ausdruck geworden. Das hat natürlich auch seinen Preis: die sichere Intonation innerhalb des Vokalensembles
dürfte deutlich schwieriger zu erziehlen sein, ist aber unerlässlich für eine nachhaltige Interpretation dieser Musik.
Mit dem Agnus Dei III ist dann die Climax erreicht:die zwei Bassus - Stimmen bringen in vierfacher Vergrößerung den Choral "Da pacem, Domine" als Kanon in der Quinte, Tenor 2 gesellt sich dazu und intoniert in gleichen Notenwerten die Schlussworte der Messe: dona nobis pacem.
Die drei Diskantstimmen sorgen für das rasche, fließende Tempo und den erweiterten Ambitus bis zum a´´ Dieser Satz gilt als Reverenz des Komponisten gegnüber den Meistern der franko - flämischen Schule, namentlich Josquin des Prez, welcher mit seinen Lösungen, wie in der Missa "Malheur me bat", quasi Pate stand. Im letzten Satz weist eben alles auf den Ursprung zurück: keinerlei Modulationen, nur im letzten Zusammentreffen der Stimmen das erlösende cis...
Jörg Schnepel, 17. Juni 2022
Mehr Informationen
Ausgabeart: Chorpartitur
Format: 210 x 297 mm
Seiten: 88