

Béla Bartók
1. Konzert
Kurz-Instrumentierung: 2 2 2 2 - 4 2 3 0 - Pk, Schl(3), Str(10 10 6 6 6)
Dauer: 23'
Übersetzer: Isabelle Dupont, Renate Stark-Voit
Bearbeitung und Mitarbeit von: Maria Koren
Herausgeber: Peter Bartók
Vorwort von: Peter Bartók
Solisten:
Klavier
Instrumentierungsdetails:
1. Flöte
2. Flöte (+Picc)
1. Oboe
2. Oboe (+Eh)
1. Klarinette in B
2. Klarinette in B und A (+Bkl(A)
Bkl(B))
1. Fagott
2. Fagott
1. Horn in F
2. Horn in F
3. Horn in F
4. Horn in F
1. Trompete in C
2. Trompete in C
1. Posaune
2. Posaune
Bassposaune
Pauken
Schlagzeug(3)
Violine I(10)
Violine II(10)
Viola(6)
Violoncello(6)
Kontrabass(6)
Bartók - 1. Konzert für Klavier und Orchester
Gedruckt/Digital
Übersetzung, Abdrucke und mehr
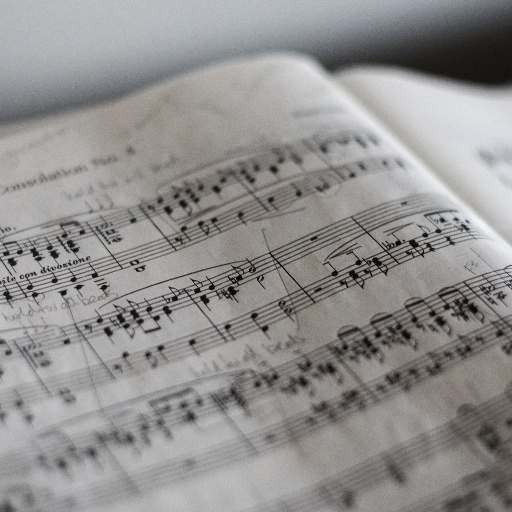
Béla Bartók
Bartók: 1. Konzert - PartiturInstrumentierung: für Klavier und Orchester
Ausgabeart: Dirigierpartitur (Sonderanfertigung)

Béla Bartók
Bartók: Klavierkonzert Nr. 1 für 2 Klaviere zu 4 HändenInstrumentierung: für 2 Klaviere zu 4 Händen
Ausgabeart: Klavierauszug
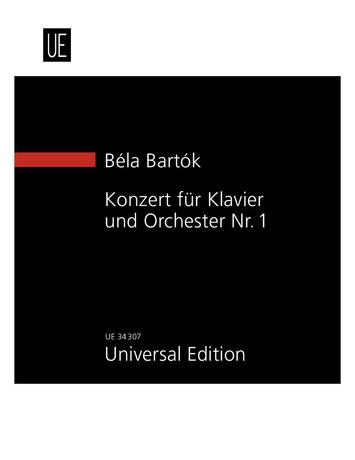
Béla Bartók
Klavierkonzert Nr. 1Instrumentierung: für Klavier und Orchester
Ausgabeart: Studienpartitur
Hörbeispiel
Werkeinführung
Béla Bartók schrieb das erste seiner drei Klavierkonzerte im Herbst 1926 für eigene Konzertauftritte. Die Erstaufführung fand am 1. Juli 1927 in Frankfurt/Main statt, im Rahmen des Festivals der IGNM, mit Bartók als Solist und Wilhelm Furtwängler als Dirigent.
Das Werk spiegelt in vollkommenster Weise Bartóks Kompositionsprofi l in jener Phase seiner Entwicklung, in welcher sich das Streben zu einer Synthese andeutet: Neben stark ausgeprägtem Vitalismus zeigt sich eine Tendenz, das eroberte und überprüfte originale Klangmaterial mit klassischen Idealen und Formen zu verbinden. Einerseits eine präzise Organisation, die klar in allen Parametern der musikalischen Sprache erkennbar ist, Sachlichkeit und Objektivierung, anderseits Gefühlsfülle, Impulsivität und musikalische Kraft von dionysischer Vitalität und eine warme Menschlichkeit. Dieses 1. Konzert für Klavier und Orchester mag auf den ersten Blick die ästhetischen Postulate des frühen Strawinsky zu sehr betonen, – besonders was die rhythmische Energie und den „brut”-Klang betrifft – unter dieser ersten auditiven Schicht aber verbirgt sich eine nur Bartók eigentümliche Musikwelt mit der logischen Ausgeglichenheit aller Elemente, auf die auch ein Schatten apollinischer Züge fällt.
Die drei Sätze sind stark monothematisch miteinander verbunden, wie auch alles thematische Material auf Grund der monothematisch-variativen Methode aus einem einzigen Kern wächst. In der klar und deutlich gegliederten formalen Organisation herrscht eine modale, folkloristisch gefärbte, diatonische Motivik, die sich meist als Ausschnitt aus einer Skala zeigt und nur selten deren gesamten Umfang erreicht. Nach dem Prinzip, das Bartók in jener Zeit vertrat „je einfacher die Melodie, desto ungewohnter muss der Begleitklang sein”, unterlegt er diese einfachen melodischen Linien und Motive, die sich linear reich miteinander verweben (nach der Technik der „veränderlichen oder wechselnden Diatonik”) und oft in verschiedenen tonalen Schichten bewegen, mit harten chromatischen vertikalen Zusammenklängen. Doch sind die deutlichen Schwerpunkte der tonalen Zentralisation schon bewusst betont. Als tragendes Element ist eine rhythmische Kraft von ungewöhnlicher Intensität und Reichtum, voll betonter aber irregulärer Pulsation häufi ger Taktwechsel und verschiedenartiger Bau der Takte eingesetzt. Diese Komponenten ergeben ein Werk mit souveränen, kräftigen Zügen und von vollkommener technischer Meisterschaft, welches schon Anzeichen späterer Beruhigung des Tonus, Beschränkung der Emotion und der technischen Mittel andeutet: eine Konsequenz der Reife.
Der durchschlagende Erfolg in Europa seiner Tanz-Suite sowie seiner Konzertreisen mag Béla Bartók dazu bewogen haben, sich nach einer längeren Schaffenspause 1926 wieder an die Komposition neuer Werke zu machen. Zusätzlich zu mehreren Stücken für Klavier solo entstand sein 1. Konzert für Klavier und Orchester, das sein Interesse an der Barockmusik bekundet. Er bestrebte auch die „Verfeinerung der Klaviertechnik”, einen durchsichtiger, „knöcherner und muskulärer” Klavierstil. Das Instrument im Klavierkonzert wird eher als Schlagzeug behandelt. Wegen seiner Schwierigkeit und Neuartigkeit setzte sich das Werk zunächst langsam durch, was den Komponisten dazu veranlasste, es zu verteidigen: „Das Klavierkonzert ist viel besser und bedeutender als die Tanz-Suite.”
Bálint Varga
