

Gustav Mahler
10. Symphonie
Kurz-Instrumentierung: 4 4 5 4 - 6 4 4 2 - Pk(2), Schl(9), Hf(2), Cel, Thr, Kor, Git, Str
Dauer: 75'
Bearbeitet von: Rudolf Barshai
Instrumentierungsdetails:
1. Flöte
2. Flöte
3. Flöte (+2. Picc)
4. Flöte (+1. Picc)
1. Oboe
2. Oboe
3. Oboe (+2. Eh)
4. Oboe (+1. Eh)
kleine Klarinette in Es (+4. Kl(B))
1. Klarinette in B (+ Kl.(A))
2. Klarinette in B (+Kl(A)
2. Kl(Es))
3. Klarinette in B (+Kl(A)
2. Bkl(B))
Bassklarinette in B
1. Fagott
2. Fagott
3. Fagott (+2. Kfg)
4. Fagott (+1. Kfg)
1. Horn in F
2. Horn in F
3. Horn in F
4. Horn in F
5. Horn in F
6. Horn in F
Tenorhorn in B
1. Trompete in F (+ Trp(C))
2. Trompete in F (+ Trp(B)
Trp.(C))
3. Trompete in F (+ Trp(B))
4. Trompete in F (+ Trp(B))
Kornett in B
1. Posaune
2. Posaune
3. Posaune
4. Posaune
1. Basstuba
2. Basstuba
1. Pauken
2. Pauken
Schlagzeug(9): 2 Xylophone, Marimbaphon, Crotales, Glocken, 2 Glockenspiele, Gong, Kastagnetten, Peitsche, Rute, Holzblock, Triangel, Becken, Tam-Tam, Tomtom, Tamburin, kleine Trommel, große Trommel, Becken auf der großen Trommel montiert, große Militärtrommel
1. Harfe
2. Harfe
Celesta
Gitarre
Violine I
Violine II
Viola
Violoncello
Kontrabass
Mahler - 10. Symphonie für Orchester
Gedruckt/Digital
Übersetzung, Abdrucke und mehr
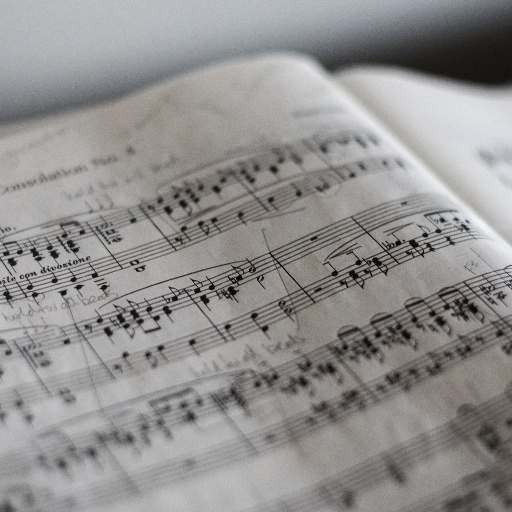
Gustav Mahler
Mahler: 10. Symphonie Fis-DurInstrumentierung: für Orchester
Ausgabeart: Dirigierpartitur

Gustav Mahler
Mahler: Symphonie Nr.10 Fis-Dur für OrchesterInstrumentierung: für Orchester
Ausgabeart: Studienpartitur
Musterseiten
Hörbeispiel
Werkeinführung
Bernd Feuchtner: Ein neues Mahler-Bild
Was die Zehnte Symphonie durch Barschai gewann
Dass Mahlers Zehnte nicht oft auf den Konzertprogrammen erscheint, liegt daran, dass der Komponist sie nicht vollenden konnte – für drei der fünf Sätze liegen nur Skizzen und ein Grundgerüst vor. Diese wurden zwar von Deryck Cooke in den sechziger Jahren auf sehr verdienstvolle Weise dechiffriert und editiert, so dass eine Aufführung der Symphonie mit vollem Orchester möglich ist, doch blieb da immer ein Unbehagen aufgrund des unbefriedigenden Gesamteindrucks: Es fehlte sowohl an Klangfülle und Wucht als auch an Plastizität des Gesamtentwurfs.
Dass die Zehnte einen weiteren Schritt nach vorn tut, zeigt das musikalische Material. Im ersten Scherzo macht Mahler sich von rhythmischen Grenzen frei wie Strawinsky und Berg, entwickelt er spielerisch aus volkstümlichem Material den Stoff der Zukunft. Wie Bergs Wozzeck ist die Symphonie in Bogenform konzipiert: Zwei große Adagios in Sonatensatzform umschließen zwei vehemente Scherzi, die von dem kurzen „Purgatorio“ als Achsenpunkt auseinander gehalten werden. Und tatsächlich lässt sich von hier aus die zweite Wiener Schule vorhersehen. Mahler ist hier so weit, dass man wie bei seinen Nachfolgern nicht mehr sagen kann, eine Sekunde oder Septime sei eine Dissonanz. Deshalb sollte man von Abweichungen gegenüber Mahlers Skizzen absehen; beim schwierigen Entziffern von Mahlers Handschrift wird gerne harmonisch geglättet, was besser schroff bliebe. Etliche Stellen werden durch die unentschiedene Harmonik erst wirklich teuflisch. Und mit dem Teufel geht es in dieser Symphonie zu – nun wird er in seiner ganzen Monstrosität sichtbar. Rudolf Barschai hatte die Zehnte Ende der 80er Jahre beim ORF in Wien und in Montpellier dirigiert. Dass sich das Unbehagen, das er dabei empfand, nicht mitein paar Korrekturen hier und da beheben ließ, fand er bald heraus: Das Ändern an Kleinigkeiten war sinnlos, es musste eine eigene Bearbeitung her. Die Cooke-Version bleibt die Grundlage und Vorarbeit, aber durch die Barschai-Version hat die Zehnte eine neue Gestalt gewonnen, die Mahlers Intentionen ein Stück näher kommt. Mahlers Bemerkungen in den Skizzen der Zehnten sind von persönlicher, ja intimer Art. Viel wichtiger – weil musikalisch – sind Zitate musikalischer Charaktere oder ein Bachzitat. Das noch von Mahler fertiggestellte „Purgatorio“ ist wie andere seiner Symphoniesätze aus einem Lied gewonnen, dem „Irdischen Leben“. Das war eine Parabel auf den Weltlauf, der die Bedürfnisse nicht erfüllt, sondern bürokratisch verwaltet. In der Symphonie dient dies einem höheren Gedanken.
Die symphonische Darstellung dieser großen Gedanken erfordert das reiche, vollklingende Mahlerorchester mit seinen stark von den Streichern bestimmten Farben, nicht skizzenhafte Linien. Im ersten Satz klingen viele Stellen leer, weil sie unvollendet sind, und es sind dabei verschiedene Varianten denkbar; wir kennen die Spuren von Verbesserungsversuchen von Mahlers Hand. In Takt 101 beispielsweise entstehen auf dem letzten Sechzehntel Paralleloktaven, was der Regel nach streng verboten ist und Mahler großes Kopfzerbrechen verursacht hat. Cooke hat diese Stelle nicht gelöst, was gewissermaßen Schande über einen großen Komponisten bringt. Dass sie solchen Fragen nicht ausweicht, ist einer der Hauptvorzüge von Barschais Bearbeitung. Dabei nutzt er typisch Mahler’sche Handgriffe breit aus, etwa die Konfrontation von gleichzeitigem Fortissimo und Pianissimo in verschiedenen Instrumentengruppen – im Adagio der Neunten entwickeln auf dem Kulminationspunkt die Streicher ihre volle Kraft, während die Bläser die Linie im Pianissimo verdoppeln. Diese Mahler’sche Erfindung führt zu phantastischen Effekten und musste in der Zehnten natürlich genutzt werden. Verwandt ist die Stelle bei Takt 153, wo die Oboe piano espressivo spielt und die 2. Violine pp ohne Ausdruck, was einen entscheidenden Unterschied im Klang hervorruft.
Im zweiten Satz wertete Rudolf Barschai vor allem die Errungenschaften Mahlers bei der Verwendung des Schlagzeugs aus. Die letzten vier Takte zeigen deshalb eine besonders reiche Schlagzeug-Partie. Im vierten Satz geht es hingegen zu Beginn und auch im allgemeinen um ganz andere Instrumentationsprinzipien, ebenso beim 5. Satz. Hier wird die Musikwissenschaft ein reiches Feld der Forschung finden. Es besteht zwar eine Verwandtschaft des zweiten Scherzos mit dem ersten Satz des Lied von der Erde und seiner Verhöhnung des „morschen Tandes dieser Erde“, aber das Scherzo geht viel weiter. Hier sind Mahlers Bemerkungen („der Teufel tanzt es mit mir“) tatsächlich programmatisch gemeint. Da macht sich der Teufel sogar elegant, um den Verführer zu spielen. Das muss wirklich sinnlich klingen.
Cookes Absicht war es, die Skizze hörbar werden zu lassen. Barschais Bearbeitung möchte den vollen Klang des Mahlerorchesters entwickeln, das sich in dieser Fassung so umfassend involviert sieht wie in Mahlers anderen Symphonien. So hatte Cooke im zweiten Scherzo in den Takten 157 ff Mahlers markante Basslinie mit dem Hauptrhythmus des Satzes lediglich der Soloposaune im forte anvertraut, was etwas grotesk klingt. Durch die Verkürzung der Noten wird zudem ein Scherzoso daraus. In Barschais Sicht liefert diese Stelle jedoch einen entscheidenden Energieschub zum Höhepunkt des Satzes hin und wird deshalb von allen tiefen Instrumenten und der Bassposaune „markig“ unterstützt und in den originalen Notenlängen Mahlers gespielt.
Das Finale enthält etliche besonders schwer zu entziffernde Stellen. Mahler war bei der Verwendung von Vor- und Auflösungszeichen auf diesem freien tonalen Gebiet nicht immer ganz konsequent. Die Aufgabe des Bearbeiters war es, hier sowohl die Motive erkennbar zu machen als auch triviale Harmonien zu vermeiden, dann erst wird der Sinn deutlich. Bei Takt 53 bis 55 wird bei Cooke die Harmonie extrem trivial, weil er sie durch eine ihm unklare Note nahezu kriminell nach es-moll umfälscht und damit elementar gegen Mahlers Philosophie verstößt. In Takt 54 nämlich gehen die oberen Streicher in der Melodie durch ein ges, das in starkem Konflikt zu dem g des Es-Dur der ersten und zweiten Stimme steht – ein großer, elementarer harmonischer Konflikt, der eine schmerzhafte Dissonanz erzeugt. Schulharmonik aber ist bei Mahler unangemessen.
Zudem wirkt dieser Moment bei Cooke schwermütig – eine Haltung, die so gar nicht in Mahlers Philosophie passt. Nun steht aber in der fünften Stimme noch eine weitere in Mahlers Hand unklare Note, die man als ces lesen könnte. Barschai neigt jedoch dazu, darin ein des zu erkennen, was für eine bedeutsame Stimmungsänderung der ganzen Stelle sorgt, ja Schwung in die Sache bringt. Nun bewegen wir uns nämlich in As-Dur, und zwar dem Dominantseptakkord dieser Tonart, der sich bereits auf dem spannungsvollen Weg zu FisDur befindet, das alsbald in überwältigender Natürlichkeit folgt. Nimmt man hier also Mahler nicht ernst, tritt entweder jene süßliche Sentimentalität ein, die ihm fremd ist, oder aber eine Hoffnungslosigkeit, die sich ebenso wenig mit allem verträgt, was wir von ihm kennen und wissen. Ein ebenso bedeutsamer Unterschied findet sich bei Takt 155. In Takt 390 unterlief Cooke ein gravierender Fehler, indem er Kontrabass und Kontrafagott eis spielen lässt statt e, und dadurch leider eine scharfe Dissonanz eliminiert.
Der Schluss der Symphonie darf keineswegs bittersüß erscheinen – er changiert zwischen Bitterkeit und Ruhe. Der Zweifel verlässt Mahler nicht, und deshalb muss es an einigen Stellen wehtun. Elf Takte vor dem Schluss wurde eine Bassnote als fis gelesen, die jedoch als eis einen Stachel zu setzen hat. Als unvorbereiteter Vorhalt schafft sie die gewaltige Spannung, die die Magie des Schlusses erst freisetzt. Auch die folgende Melodie wird dadurch in ein anderes Licht gesetzt: Barschai hört sie als Schubert-Zitat und lässt sie deshalb von den Posaunen zu erhabener Andacht spielen. Nach zwei etwas zögernden Bassklarinetten tritt eine große Explosion wie ein Erdbeben ein, gefolgt von einem Diminuendo, bevor die ewige Ruhe des Fis-Dur einkehrt. Der bedeutende Mahler-Kenner Jonathan Carr zeigte sich durch die unerwartete Spannung, die die letzten 20 Minuten der Partitur durch Barschais Bearbeitung gewannen, besonders beeindruckt.
Solche Feinheiten, die freilich entscheidend sind für die Bestimmung der musikalischen Gesamtform, waren erst einem Musiker wie Rudolf Barschai zugänglich, der sein Leben der Interpretation der großen europäischen Symphonik gewidmet und viele Jahre mit Mahlers Musik gelebt hat.
Bernd Feuchtner
