

Florian Bergmann
Alter Ego
Dauer: 8'
Instrumentierungsdetails:
1.Altsaxophon in Es
2.Altsaxophon in Es
3.Altsaxophon in Es
4.Altsaxophon in Es
Alter Ego
Übersetzung, Abdrucke und mehr
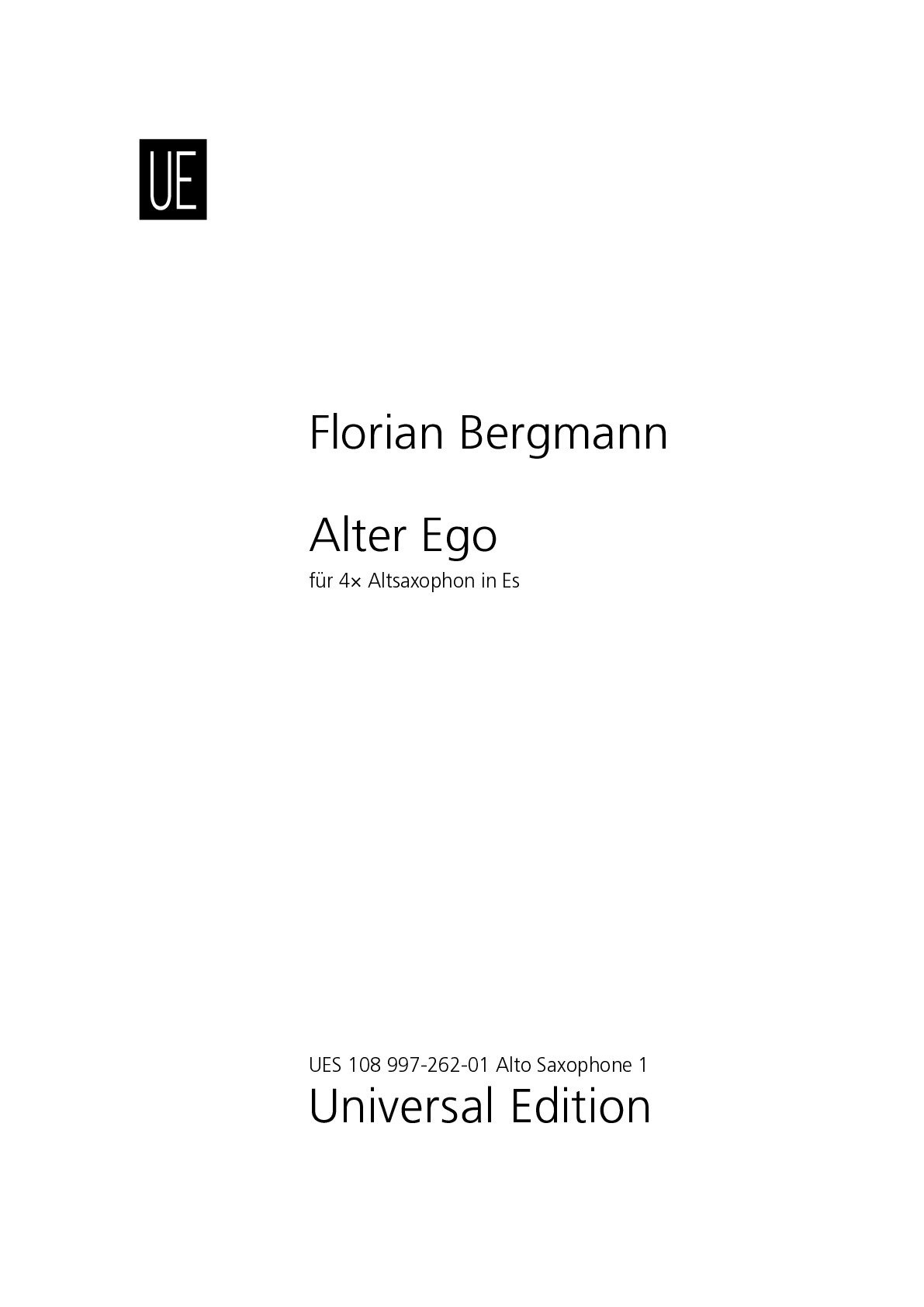
Florian Bergmann
1. Altsaxophon in Es (Alter Ego)Ausgabeart: Stimme
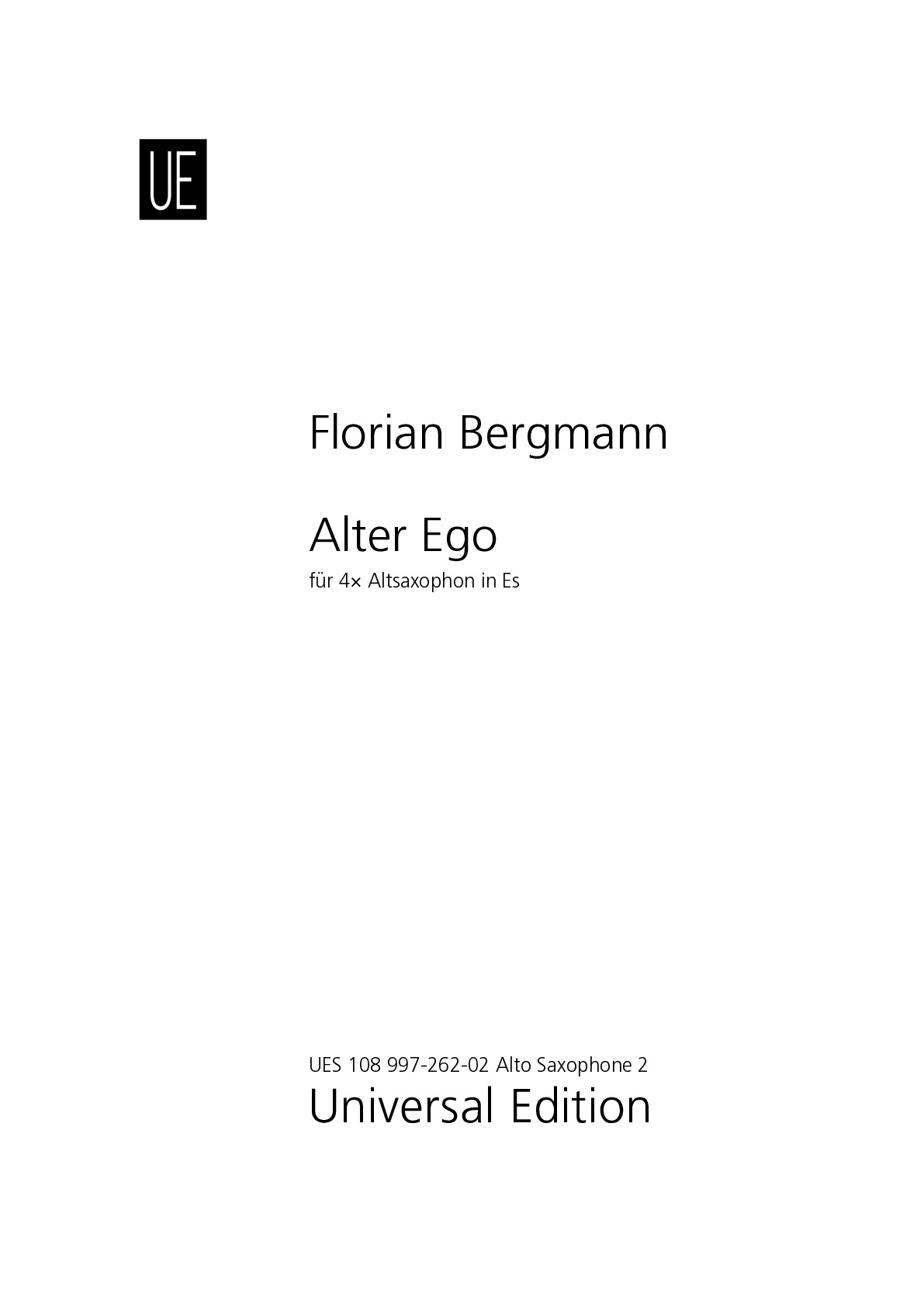
Florian Bergmann
2. Altsaxophon in Es (Alter Ego)Ausgabeart: Stimme
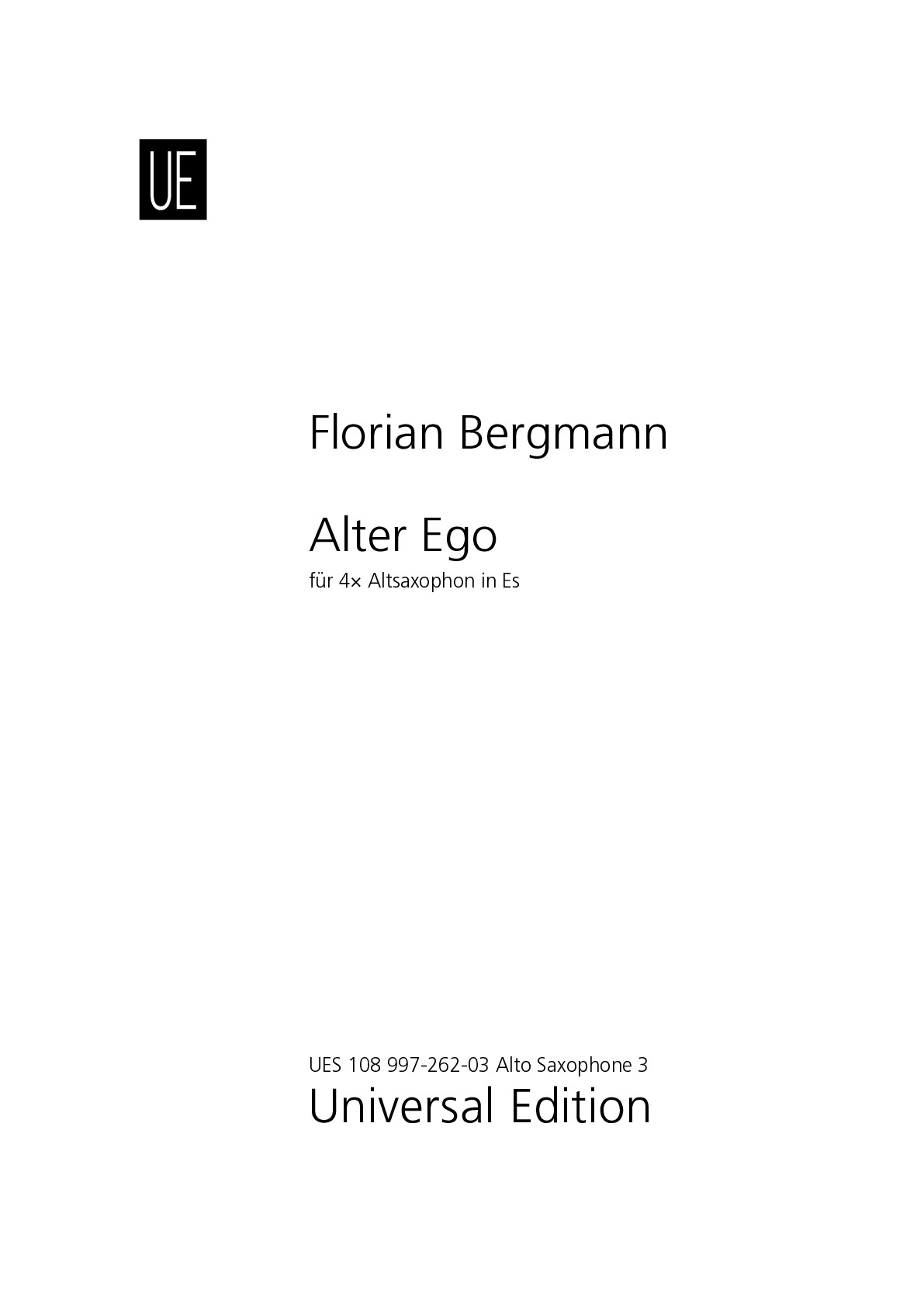
Florian Bergmann
3. Altsaxophon in Es (Alter Ego)Ausgabeart: Stimme
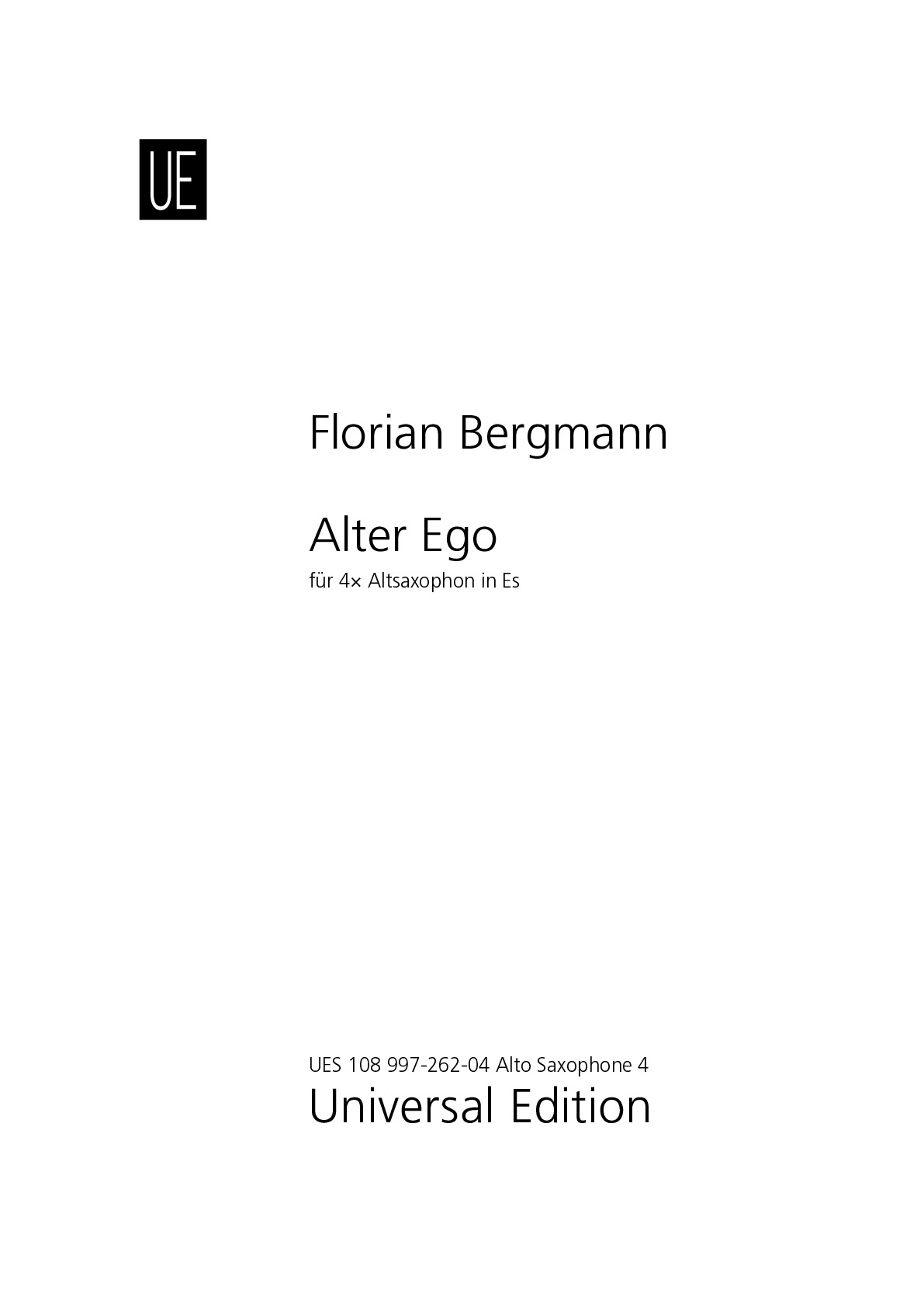
Florian Bergmann
4. Altsaxophon in Es (Alter Ego)Ausgabeart: Stimme
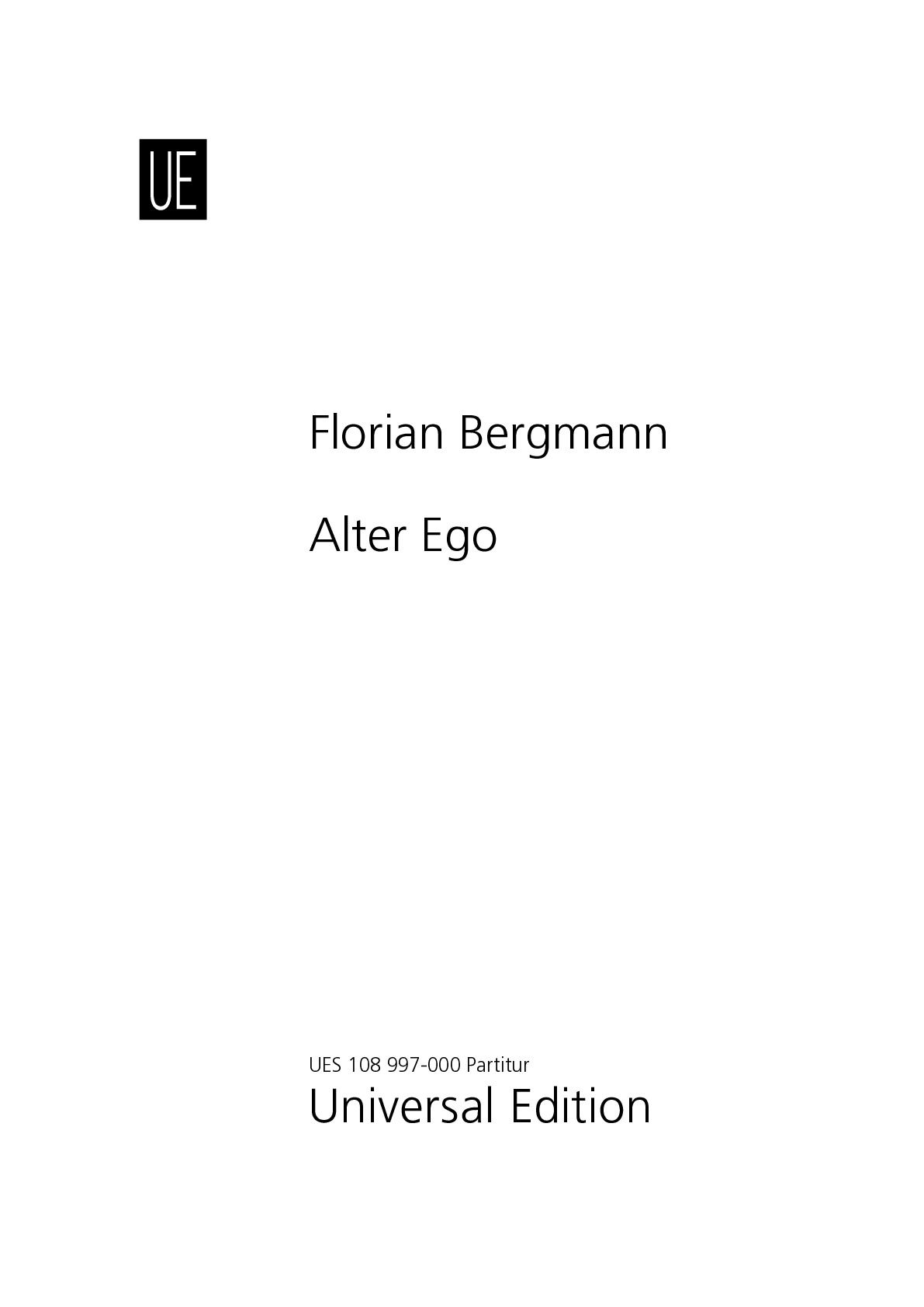
Musterseiten
Werkeinführung
Alter Ego ist ein Stück für Altsaxophonquartett und Zuspiel. Es entstand 2025 für das Ensemble Fo[u]r Alto, in dem ich als Saxophonist langjähriges Mitglied bin und mit welchem wir über die Jahre einen sehr eigenständigen, häufig auf Mikrotonalität und erweiterten Spieltechniken beruhenden Ensembleklang entwickelt haben.
In der Psychologie beschreibt der Begriff „Alter Ego“ auf zweifache Weise eine starke Identifikation des Ichs mit einem nahen Gegenüber: Einerseits als ein äußerst intensives Verhältnis zwischen zwei Personen, durch welches die eine Person für die andere gewissermaßen zu einem Teil der eigenen Identität wird; andererseits als ein zweites, abgespaltenes Ich innerhalb ein und derselben Psyche.
Die Komposition Alter Ego ist auf vielerlei Weise von dieser Idee der (Selbst-)Identifikation und Abspaltung durchdrungen.
Zunächst ist dort das Altsaxophonquartett als extrem homogener Klangkörper, der sich von der klassischen Saxophonquartett-Besetzung in der Konzentration auf nur ein Mitglied der Saxophonfamilie drastisch unterscheidet. So marginal dieser Unterschied zunächst scheinen mag, so groß sind seine Konsequenzen für die musikalische Struktur – so groß, dass es in der Tat als eine andere Besetzungsgattung betrachtet werden muss.
Innerhalb des Quartetts stehen sich die Interpreten als gegenseitige Identifikationsfiguren gegenüber. Im Unisono verschmilzt ihr Klang zu einem einzigen, unzertrennbaren Ton und in der durchbrochenen Melodik spiegeln und ergänzen sie sich zu einem Ganzen. Durch die Raumdisposition der Spieler in den vier Ecken des Aufführungsraumes wird die Frage aufgeworfen, ob es sich um vier getrennte – wenn auch symbiotisch aufeinander bezogene – Individuen oder um einen gemeinsamen Organismus handelt.
Diese Fragestellung wird weiter verstärkt durch das Hinzutreten des Zuspiels. Jedem Spieler ist ein Lautsprecher zur Seite gestellt, aus welchem zuvor vom Spieler selbst aufgenommene Passagen erklingen. Die Identifikationsbeziehungen multiplizieren sich durch die aus den Lautsprechern erklingenden Saxophone: Einerseits zerfällt das ursprüngliche Quartett in vier getrennte Individuen, von denen jedes wiederum in ein Wechselspiel mit den eigenen, selbst aufgenommenen Saxophonstimmen tritt – also buchstäblich in ein Wechselspiel mit sich selbst. Andererseits fügt sich das Quartett noch enger zusammen und positioniert sich seinem eigenen, doppelten (da achtspurigen) Lautsprecher-Spiegelbild gegenüber. Auf einer Metaebene entsteht aus dem Diskurs zwischen Live-Quartett und Lautsprecher-Oktett eine gemeinsame, komplexe Struktur, welche im zentralen Teil des Stücks alle Wechselbeziehungen verdichtet und kulminiert.
Was braucht man, um dieses Werk aufzuführen?
Für die Aufführung des Stücks wird ein 4-Kanal-Audiosystem mit vier Lautsprechern benötigt.
