

Alfred Schnittke
Concerto grosso
Dauer: 25'
Widmung: Gidon Kremer, Tatjana Gridenko und Saulus Sondeckis gewidmet
Schnittke - Concerto grosso für 2 Violinen, Cembalo (od. Klavier) und Streichorchester
Übersetzung, Abdrucke und mehr
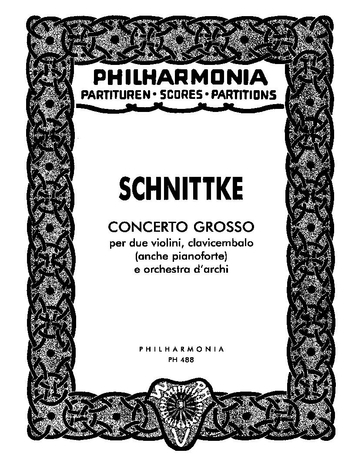
Alfred Schnittke
Schnittke: Concerto Grosso für 2 Violinen, Cembalo (od. Klavier) und StreichorchesterInstrumentierung: für 2 Violinen, Cembalo (od. Klavier) und Streichorchester
Ausgabeart: Taschenpartitur
Hörbeispiel
Werkeinführung
„Im Lauf mehrerer Jahre war es für mich ein inneres Bedürfnis, Theater- und Filmmusik zu schreiben. Anfangs machte es mir noch Spaß, aber schon bald wurde ich dessen überdrüssig. Erst später ging mir ein Licht auf: Die Aufgabe meines Lebens besteht darin, die Kluft zwischen E- und U-Musik zu überbrücken, auch wenn ich mir dabei den Hals breche.“ – Bekenntnisse eines Komponisten in der Sowjetunion Ende der siebziger Jahre. Oder: die seltsamen Verfremdungen des Herrn Schnittke. Zwei Sologeigen, Cembalo und präpariertes Klavier und begleitendes Streichorchester unter der Werküberschrift Concerto grosso Nr. 1. Ein Werk, das der Geiger Gidon Kremer sich von ihm gewünscht hatte. Alfred Schnittke überreichte dem jungen Musiker das Werk zu dessen 30. Geburtstag, 1977. Kremer machte auch eine Aufführung im damaligen Leningrad möglich. Eine Schallplatte wurde bald aufgenommen. Erklang da etwa die Fratze eines barocken Concerto grosso? Immer wieder brach da auch die Sphäre des Banalen ein: im letzten Satz in Gestalt eines Tangos.
„Mir schwebt ein utopischer einheitlicher Stil vor, bei dem die Fragmente der E- und U-Musik keine grotesken Einschübe wären, sondern Elemente einer mannigfaltigen musikalischen Realität. Ich meine damit Elemente, die in ihrer Ausdruckskraft zwar real sind, jedoch manipuliert werden können, sei es Jazz-, Pop-, Rock- oder serielle Musik (denn schließlich ist auch die avantgardistische Musik bereits zur Ware geworden).“ – Schnittke hatte Ende der sechziger Jahre für sich das Ideal einer polystilistischen Musik konzipiert: ein Zusammenwirken von Zitaten unterschiedlicher Epochen und von ihm neu erfundenen Themen, die den Anschein des Alten erweckten. Quasi-Zitate. Der von Schnittke heraufbeschworene utopische Stil zielte darauf ab, unterschiedlichste Sphären miteinander zu vereinen. Eine Musik, die sich auf diese Weise jeglicher Manipulation von außen entziehen würde. „Deshalb habe ich in das neoklassizistische Concerto grosso einige nicht stilgerechte Auszüge aus meiner früheren Filmmusik eingefügt: einen flotten Kinderchoral (im Anfang des ersten Satzes und in der Kulmination des fünften Satzes sowie als Refrain in anderen Sätzen), eine nostalgisch-atonale Trioserenade (im zweiten Satz), einen garantiert authentischen Corelli (Made in UdSSR) und den Lieblingstango meiner Großmutter, gespielt von deren Urgroßmutter auf dem Cembalo (im fünften Satz)“, so Schnittke, für den auch dieses Stück mehr als nur eine musikalische Spielerei war:
„Dennoch stehen alle diese Themen durchaus miteinander im Einklang (verminderte Sekunde, seufzende Sekunden), und ich fasse sie wirklich ernst auf. Die Form des Werkes: 1. Vorspiel, 2. Tokkata, 3. Rezitativ, 4. Kadenz, 5. Rondo, 6. Nachspiel
Programmheft Klangspuren 2010
