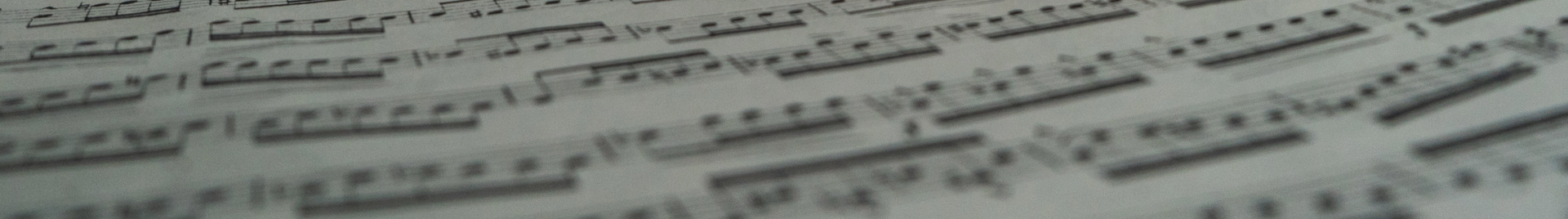

Richard Wagner
Der Ring des Nibelungen
Bearbeitung: Eberhard Kloke
Wagner - Der Ring des Nibelungen für mittelgroßes Orchester
Werkeinführung
Neuer Katalog
Richard Wagner, Bühnenfestspiel Der Ring des Nibelungen
Vorwort zur Bearbeitung
Die lebenslange Beschäftigung mit Wagners Werk und die Auseinandersetzung mit dessen Konzeption und Wirkungsgeschichte haben dazu geführt, am Musikdrama Der Ring des Nibelungen auszuloten und auszuprobieren, wie sich Wagners Partituren gewissermaßen komprimieren und für eine kleinere Orchesterbesetzung verdichten ließen. Dies geschah im Wissen um die von Wagner angeblich autorisierte, sogenannte Coburger Fassung, die nicht in Partiturform vorliegt, sondern nur in adaptierten Orchesterstimmen. Diese Coburger Fassung ist eine offenbar ad hoc geschaffene Bearbeitung für kleines Orchester, welche aus der Not geboren wurde und auf das Ring-typische Instrumentarium verzichtet und daher heutigen Ansprüchen nach einer „authentischen“ Transkription nicht genügen kann.
Bis zum 2. Akt des Siegfried wurde nicht für einen „indirekten Orchesterklang“, also für Bayreuths verdeckten Orchestergraben, sondern vielmehr für konventionelle Opernhäuser mit offenem Orchestergraben konzipiert. Es gilt sich immer bewusst zu machen, dass spätestens seit Erfindung der Mikrofonie und des Lautsprecherklanges der „mystische Abgrund“ des verdeckten, unsichtbaren Orchesters eine Art Anachronismus darstellt, wenngleich nicht bestritten werden soll, dass etwa Parsifal auf die spezifisch akustischen Verhältnisse des Bayreuther Festspielhauses zugeschnitten ist. Die Idee des indirekten Orchesterklanges ist also historisch eingeholt worden, von der technischen Entwicklung der Mikrofonie und des Lautsprecherklanges.
Es sei nicht zuletzt auch erinnert an die großen Fortschritte im Instrumentenbau der letzten 125 Jahre. Noch zu Wagners Zeiten war eine Hauptmotivation für das „verdeckte Orchester“, störende Nebengeräusche der Instrumente zu eliminieren.
Die Vorstellung von „Klang“ wandelte sich aufgrund der technischen Veränderungen vom vermischten, versteckten bzw. verdeckten und somit verstellten Klang mehr und mehr in Richtung zu offengelegten Klangstrukturen, zu analytisch geprägten und erprobten, eben zu detail-geschärften Klängen, um mittels eines sichtbaren (d. h. einsehbaren) sowie direkt hörbaren (plastisch-durchhörbaren) Orchesterklanges den musikalischen Zusammenhang zu verdeutlichen. Damit soll nicht postuliert werden, dass eine Interpretation umso besser oder authentischer sei, je weiter sie sich vom ursprünglichen Werkcharakter entfernt. Vielmehr soll damit zum Ausdruck gebracht werden, dass sich durch verschiedene Veränderungen und Entwicklungen (eben durch Bearbeitungen, Instrumentenbau, Mikrofonie- und Lautsprechertechnik sowie Veränderung des Rezeptionsverhaltens) die Perspektive eines Werkes, die Produktion (Interpretation) und damit auch die Rezeption von Musik verändern.
Man unterliegt einem weitverbreiteten Irrtum zu glauben, dass Wagner – insbesondere Der Ring – an deutschsprachigen Opernhäusern „original“ aufgeführt wird. Sogar in den sogenannten „big five/seven“ der deutschsprachigen Opernhäuser wird Wagner nur mit reduzierter Streicherbesetzung gespielt.
Bei einer ersten Recherche darüber, in welcher Streicherbesetzung konkret der Ring innerhalb der deutschsprachigen Bühnenlandschaft aufgeführt wurde/wird, stellte sich gleich heraus, dass keines der sogar größeren deutschsprachigen Opernhäuser in der von Wagner ausdrücklich vorgeschriebenen Orchesterbesetzung – namentlich der Streicher – spielt. Wagners geforderte Streicherbesetzung lautet 16/16/12/12/8 und wird tatsächlich nur in Bayreuth realisiert.
Folgende große Opernhäuser spielten den Ring in der letzten Zeit in folgenden Streicherbesetzungen:
Wien: 14/12/10/8/8
Berlin: 14/12/10/8/7
München: 14/12/10/8/7
Stuttgart, Rheingold und Walküre: 13/10/10/10/5; Siegfried und Götterdämmerung: 14/12/10/8/5
Hamburg: 14/11/10/8/6
Frankfurt: 14/12/10/8/6
Zürich: 12/10/8/6/5
Bei den mittleren und kleineren Opernhäusern verschiebt sich das Besetzungsverhältnis entsprechend weiter zu Ungunsten des Originals.
Dieses Missverhältnis zwischen Streicher- und Bläserbesetzung hinsichtlich der aufführungspraktischen Realität der meisten Opernhäuser bei einer aktuellen Neu-Bearbeitung grundsätzlich zu korrigieren, ist neben dem Aspekt, eine Spielmöglichkeit auch für kleinere Bühnen zu ermöglichen, einer der Ausgangspunkte gewesen.
Zentrales Anliegen für eine neue Transkription von Wagners Der Ring des Nibelungen war also, sowohl eine aufführungspraktische Alternative – bei grundsätzlicher Beibehaltung der Wagnerschen Partitur – als auch eine neue Klangausrichtung für das Werk herzustellen. Dieser Versuch sollte jedoch nicht mit den Ansätzen der sogenannten historisch informierten Interpretationspraxis verwechselt werden. Bei der vorliegenden Transkription geht es um eine nicht geringfügige Veränderung des Klangbildes und damit der Klangstruktur innerhalb des Orchesters sowie der Balance zwischen Bühne und Orchester. Dem vermeintlichen Verlust von „großem Opernklang“ wird eine radikalere kompositorisch-klangliche Substanz entgegengesetzt – im Sinne einer Feinabstimmung zwischen den Sängern und dem deutlich verkleinerten Orchester. Es ergibt sich hieraus die Möglichkeit einer größeren Flexibilität bei der Besetzung der Sänger in Richtung von schlankeren und „sprachfähigeren“ Stimmen, die nicht ausdrücklich auf das hochdramatische Fach spezialisiert sind. Textverständlichkeit und klangliche Transparenz sollen die theatralische Präsenz erhöhen, was Wagners musiktheatralischem Anliegen unzweifelhaft entspricht. In diesem Zusammenhang sei an Wagners Worte erinnert, die er vor der Ring-Uraufführung 1876 an die Sänger richtete: „Deutlichkeit! – Die großen Noten kommen von selbst; die kleinen Noten und ihr Text sind die Hauptsache.“
Im Zuge der Bearbeitung wurden die Klangfarben des Orchesters durch Ausdifferenzierung innerhalb des historisch vorgegebenen Spektrums und durch Einführung neuer Instrumente erweitert und „modernisiert“. Es wurde sowohl eine Erweiterung als auch Verdichtung des Klanges angestrebt, zumal die Ring-typischen Instrumente wie Wagnertuba, Basstrompete und Kontrabassposaune selbstverständlich beibehalten wurden. Den neu eingeführten Instrumenten Altflöte, Heckelphon, Kontrabassklarinette, Kontrafagott und Cimbasso (als Bindeglied zu Tuben und Posaunen) wird besondere Bedeutung als zusätzliche dramatisch-psychologische Klangträger zuteil.
Die Orchesterbesetzung der Ring-Opern in der vorliegenden Transkription ist auf die Stärke eines mittelgroßen Orchesters ausgerichtet:
Rheingold: Besetzungsstärke 54
Walküre: Besetzungsstärke 57
Siegfried: Besetzungsstärke 60
Götterdämmerung: Besetzungsstärke 63
Schlussbemerkung:
Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass die Einzelwerke ohne Streichungen bearbeitet wurden. Die Auswirkung auf opernpraktische Konsequenzen im Hinblick auf variable Besetzungsalternativen in Richtung schlankere, sprachfähigere Stimmen, wird sich einstellen. Textverständlichkeit und Klang-Transparenz werden die theatralische Präsenz erhöhen, welches Wagners postuliertem musik-theatralischem Anliegen entspräche.
Es bleibt allemal spannend, durch zahlreiche Aufführungen zu erleben und konkret nachzuvollziehen, inwieweit die aufführungspraktischen Konsequenzen der Transkription generell eine neue Sicht und Hörperspektive auf das Wagnersche Werk ermöglichen könnten.
Andreas Prohaska sei gedankt für die Mithilfe bei der „Definition“ des Sängerapparates und die kritische Begleitung bei der Neufassung/Kürzung der Szenen- und Regieanweisungen. Besonders zu danken ist Heinz Stolba (UE) für seine engagierte, die Transkriptionsarbeit stets begleitende Lektorats-Arbeit.
Eberhard Kloke, Berlin im November 2012
Eine Broschüre mit detaillierten Informationen zur Bearbeitung und Besetzung (Besetzungsüberschneidungen und Doppelbesetzungsoptionen) ist bei Universal Edition erhältlich: [email protected]
