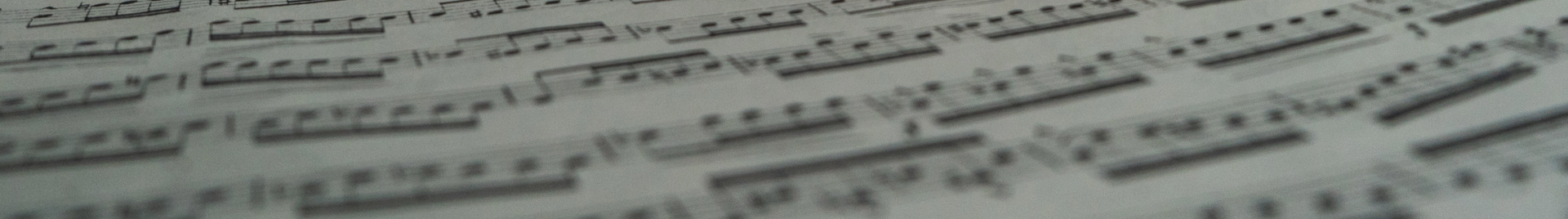

Richard Wagner
Götterdämmerung
Kurz-Instrumentierung: 3 3 3 3 - 6 2 4 1 - Pk, Schl(2), Hf, Cel, Str(10 8 6 5 4)
Dauer: 270'
Bearbeitet von: Eberhard Kloke
Instrumentierungsdetails:
1. Flöte
2. Flöte (+Afl(G))
3. Flöte (+Picc)
1. Oboe
2. Oboe (+Eh)
3. Oboe (+Eh, Hph ad lib)
1. Klarinette in B (+Kl(A))
2. Klarinette in B (+Kl(A), Bkl(B))
3. Klarinette in B (+Kl(A), Bkl(B), KbKl(B) ad lib)
1. Fagott
2. Fagott
3. Fagott (+Kfg)
1. Horn in F
2. Horn in F
3. Horn in F (+Wgtb. in B)
4. Horn in F (+Wgtb. in B)
5. Horn in F (+Wgtb. in F)
6. Horn in F (+Wgtb. in F)
1. Trompete in C
2. Trompete in C
1. Posaune (+Btrp ad lib)
2. Posaune
3. Posaune
4. Posaune (+Kbpos)
Kontrabasstuba
Pauken
1. 2. Schlagzeug (Xylorimba ad lib, Glockenspiel, Pauken, Triangel, Becken, Tam-Tam, Rührtrommel)
Celesta
Harfe
Violine I(10)
Violine II(8)
Viola(6)
Violoncello(5)
Kontrabass(4)
Bühnenmusik (Stierhörner und 2 Hörner auf der Bühne)
Wagner - Götterdämmerung (in Vorbereitung) für mittelgroßes Orchester
Musterseiten
Werkeinführung
Die Besetzung der Transkription ist auf die Stärke eines mittelgroßen Orchesters ausgerichtet. Im Zuge der Bearbeitung wurden die Klangfarben des Orchesters durch Ausdifferenzierung innerhalb des historisch vorgegebenen Spektrums und durch Einführung neuer Instrumente erweitert und „modernisiert“. Es wurde sowohl eine Erweiterung als auch Verdichtung des Klanges angestrebt, zumal die Ring-typischen Instrumente wie Wagnertuba, Basstrompete und Kontrabassposaune selbstverständlich beibehalten wurden. Den neu eingeführten Instrumenten Altflöte, Heckelphon, Kontrabassklarinette, Kontrafagott und Cimbasso (als Bindeglied zu Tuben und Posaunen) wird besondere Bedeutung als zusätzliche dramatisch-psychologische Klangträger zuteil.
Ein Wort zu den Wagnertuben:
Im Hinblick auf eine Realisierung des Ring des Nibelungen entwickelte Wagner die Idee für eine Art modifizierte Waldhörner, den Wagner-Tuben, auch Waldhorntuben oder Ringtuben genannt. Der Zweck bestand darin, eine Art Waldhornklang für die tieferen Register – vor allem der Walhallmusik, aber auch generell zur Verdunklung des Orchesterklanges – zu bekommen. Die enger als die Basstuben mensurierten Wagnertuben sind ebenfalls transponierende Instrumente in jeweils höherer und tieferer Lage. Da die Instrumentation des Ring sich über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren erstreckte, experimentierte Wagner mit den Lagen und der Notation der Tuben: in Rheingold und im ersten Akt der Götterdämmerung sind Tenortuben in B und Basstuben in F notiert, in Walküre, Siegfried und im Rest der Götterdämmerung Tenortuben in Es und Basstuben in B. Die Basstuben in B sind in der „alten Notation“ der Hörner notiert, das heißt, dass sie im Bassschlüssel nur eine Sekunde (statt einer None) tiefer klingen. Soweit das möglich und sinnvoll war, wurde diese Notation in den Stimmen vereinheitlicht auf Tenortuben in B (hoch) und Basstuben in F (tief) fixiert, die Partitur nähert sich weitgehendst der alten Notation, um den jeweiligen experimentellen Charakter aufrechtzuerhalten. Die wesentlichen Passagen der Tenor- und Basstuben sind in die vorliegende Bearbeitung integriert.
Bei den transponierenden Instrumenten wurde praktischerweise nur mit Akzidenzien gearbeitet, Tonartvorzeichen gab es nur bei inhaltlich zwingenden Gesamtzusammen-hängen (siehe vor allem Rheingold).
Einige Beispiele für besondere Instrumentationsdetails in der Götterdämmerung:
1
1. Akt
In die Nornenszene wurden an mehreren Stellen die Instrumente Heckelphon und Kontrabassklarinette eingebaut als Klangträger, die in später folgenden Szenen klangsymbolisch wieder erscheinen.
2
Die Kontrabassklarinette erscheint am Ende der Hagenszene und am Anfang der Waltrauten-Szene und stellt somit die „innere“ Verbindunglinie her, vergleichbar der Parallelstellen der Musik zur „Weltbegrüßung“ aus Siegfried III und Götterdämmerung III.
3
Hingewiesen speziell sei auf die Instrumentation zu Beginn der 5. Szene, in der der Klang entsprechend der Szene verdunkelt und verfremdet wurde.
Eine vergleichbare Situation besteht am Ende der „Rheinfahrt“ ab Takt 851. In diesem Orchesterzwischenspiel verdüstern sich sukzessive die Klangfarben durch Einführung von Kontrafagott, Altflöte, Englischhorn und Kontrabassklarinette.
4
2. Akt, 1. Szene
Es werden „archaisierende“ Techniken wie Bogenvibrato (Streicher) und frémissement (Bläser) eingesetzt. Gezieltere Aufteilung von Bläsern und Streichern zeichnen einen Klang zuungunsten der Mischtechnik.
5
2. Akt, 2. Szene
Variierende Aufteilung und Aussparung von Bläsern bzw. Streichern versuchen den Klang zu „entfetten“.
6
2. Akt, 4. Szene, Takte ab 823
Kontabassklar. und diverse Zusatzeffekte von Xylorimba und Harfe unterstreichen die „Bodenlosigkeit“ der dramatischen Szene.
7
2. Akt ab Takt 1445: „Doch, träf’st du im Rücken ihn!“
Wagner setzt hier bezeichnender Weise die A-Klarinette ein, es sind darüber hinaus weitere instrumentatorische „Verdunklungen“ mittels Englischhorn, Heckelphon und Kontrabassklarinette („Betrüger, ich!“) vorgenommen worden, die Passage „Siegfrieds Tod“ wurde durch Anwendung des Bartók-Pizzikatos verstärkt.
8
3. Akt: Die Musik zur Siegfried-Figur und Zitate aus Siegfried in der Götterdämmerung
Die Musik zur Siegfried-Figur und die Gesangspartie speziell von Siegfried bis zur Götterdämmerung zeigt eine enorme Entwicklung auf. Die Gesangsstimme reicht von baritonaler Tiefe (Siegfried in der Gestalt und Stimme Gunthers) bis hin zum Waldvogelzitat in der großen Rückblende.
Diese besonderen Schnittstellen des Dramas herauszustreichen und instrumentatorisch kenntlich zu machen, wurden die entsprechenden Zitate aus Siegfried (in der Fassung der Bearbeitung) bezogen auf die Waldvogel-Episode und dem Weltbegrüßungsthema („Brünnhilde, heilige Braut!“) wörtlich übernommen und die Stellen mit Doppel-Taktstrich gekennzeichnet. In diesem Zusammenhang fungiert die Kontrabassklarinette als Klangträger der „Erinnerung“ mit Verweis auf die Passage in Siegfried (Bei Ziff. 51 in Siegfried wurde die „ewige Melodie“ der hohen Streicher geerdet mit einem Orgelpunkt „a“ der Kontrabassklarinette).
Beim Vergleich ähnlicher oder identischer Passagen aus dem Schlussgesang der Brünnhilde (3.Akt ab Takt 1346 + ff) und der Waltraute-Szene (1. Akt ab Takt 1294) fällt auf, dass Wagner die Instrumentation variiert, folglich wurde dies in der vorliegenden Bearbeitung noch weiter entwickelt.
Auf die konkrete Stimmfachbezeichnung wurde verzichtet, da mir dieser Bearbeitung das Werk auch mit leichteren Stimmen – nicht speziell auf hochdramatisch bezogene Fächer tradierter Art – besetzt werden kann. Die Besetzungsüberschneidungen und Doppelbesetzungsoptionen werden ab Seite 6 des Kommentars zur Gesamtbearbeitung des Ring konkretisiert.
Besetzung Götterdämmerung
Auf die konkrete Stimmfachbezeichnung wurde verzichtet, da mir dieser Bearbeitung das Werk auch mit leichteren Stimmen – nicht speziell auf hochdramatisch bezogene Fächer tradierter Art – besetzt werden kann.
Siegfried: Tenor
Gunther: Bariton
Alberich: Bariton, Bassbariton
Hagen: Bass
Brünnhilde: Sopran
Gutrune, 3. Norn, Woglinde: Sopran
Waltraute, 2. Norn, Wellgunde: Mezzosopran
1. Norn, Flosshilde: Alt
Mannen, Frauen: gemischter Chor
Orchester-Besetzung: 63 Instrumentalisten/Innen
Eberhard Kloke
Eine Broschüre mit detaillierten Informationen zur Bearbeitung und Besetzung (Besetzungsüberschneidungen und Doppelbesetzungsoptionen) ist bei Universal Edition erhältlich: [email protected]
