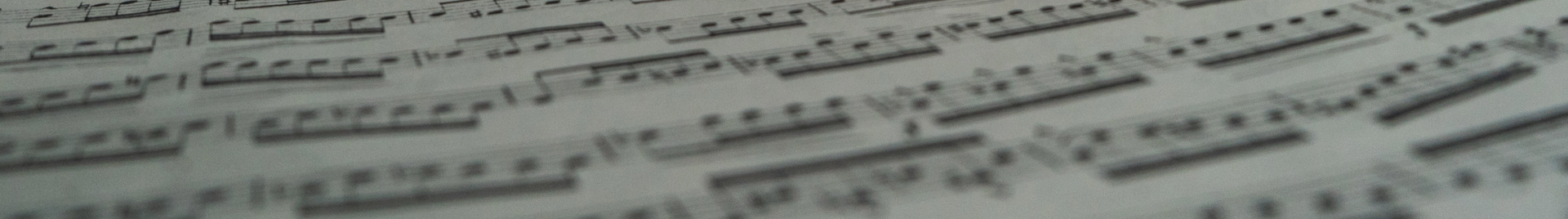

Daniele Ciminiello
Gymnopédie
Dauer: 3'
Instrumentierungsdetails:
Flöte
Violine
Viola
Violoncello
Gymnopédie
Übersetzung, Abdrucke und mehr


Daniele Ciminiello
GymnopédieInstrumentierung: for flute, violin, viola and violoncello
Ausgabeart: Dirigierpartitur



Musterseiten
Video
Werkeinführung
Wenn ich das Wort „Gymnopédie“ höre, muss ich sofort an die drei berühmten Klavierkompositionen des französischen Komponisten Erik Satie denken. Diese wunderbaren Stücke klingen wie langsame, hypnotische Tänze, und ich persönlich habe sie immer als verträumte Walzer empfunden. Aber Satie hat weder das Wort „Gymnopédie“ noch diese musikalische Form selbst erfunden. Tatsächlich ließ er sich von einer Art Tanz inspirieren, der im antiken Griechenland sehr geschätzt wurde.
Die „Gymnopédies“ waren Feste, die in Sparta zu Ehren von Apollo gefeiert wurden. Die Teilnehmer sangen und tanzten nackt um die Statue des Gottes, aufgeteilt in einen Knaben- und einen Erwachsenenchor.
In seinen Gymnopédies behielt Satie das Element der hypnotischen Wiederholung bei, das für die Volksmusik spezifisch ist, und formte es mit seinem einzigartigen musikalischen Geschmack, wodurch diese drei verträumten und melancholischen Kompositionen entstanden. In meiner eigenen Gymnopédie habe ich mich dafür entschieden, dasselbe Wiederholungselement beizubehalten, dem Stück aber einen kühneren Charakter zu verleihen. Ich habe mich für Flöte und Streichtrio entschieden, weil diese Instrumente entweder Klangfarbenkombinationen erzeugen können, die den Eindruck erwecken, dass ein einziges Instrument spielt, oder ihre eigene Identität bewahren können, indem sie einen Dualismus zwischen Flöte und Streichtrio erzeugen. Außerdem kann ich die Ähnlichkeit zwischen den Obertönen der Streicher und der Flöte nutzen, um interessantere Situationen zu schaffen.
Der erste Teil des Stücks ist eine Einleitung, die durch die Kombination der Pizzicato-Zungentechnik der Flöte mit der Pizzicato-Technik der Streicher gekennzeichnet ist, wodurch eine neue Klangfarbe entsteht. Der ständige Wechsel zwischen Unisono und Akkorden erzeugt einen Kontrast, der die Wahrnehmung des Quartetts als Einheit gegenüber der klaren Identifizierung jedes einzelnen Instruments betont. In Takt 22 nimmt die Bratsche das Hauptthema des zweiten Teils vorweg. Die Wahl der Verwendung von Flageolett-Tönen schafft eine Verbindung mit dem Klang der Flöte, die später dieselbe Melodie spielt und weiterentwickelt. Der zweite Teil beginnt bei Takt 30. Die rhythmischen Fragmente, die den ersten Teil charakterisierten, werden zusammengefügt und erzeugen ein Ostinato, das vom Cello gespielt wird. Die Flöte spielt das Hauptthema, das an einen Volkstanz erinnert, während die Violine und die Viola die Hauptakzente mit „Säbeln“ aus Flageolett-Tönen setzen.
Der kurze Abschnitt von Takt 60 bis Takt 68 wirkt wie ein Übergangsmoment im Stück. Das Ostinato wird nun von der Violine gespielt und liegt auf einem leisen Tremolo „alla punta“, das von Viola und Violoncello ausgeführt wird. Der allmähliche Übergang „sul ponticello“ in Takt 63 regt die Flageolett-Töne der beiden Instrumente an, und die Flöte fügt sich in diesen Bereich ein und spielt ein Bisbigliando. Die mikrotonale Dimension des Bisbigliando wird perfekt ergänzt durch das Glissando von Bratsche und Violoncello in den Takten 66 und 67, das diesen kurzen Abschnitt beendet, gefolgt von einem Takt allgemeiner Pause.
Von Takt 69 bis Takt 88 wird das Hauptthema zum letzten Mal wiederholt. Das Ostinato verschwindet und während die Flöte die Melodie spielt, ist das Streichtrio nun vereint und markiert die Hauptakzente der Melodie.
In Takt 89 beginnt eine Coda, die an den ersten Abschnitt erinnert. Der Rhythmus wird allmählich spärlicher und das Stück endet mit einem Unisono des Quartetts als einziges Instrument.
