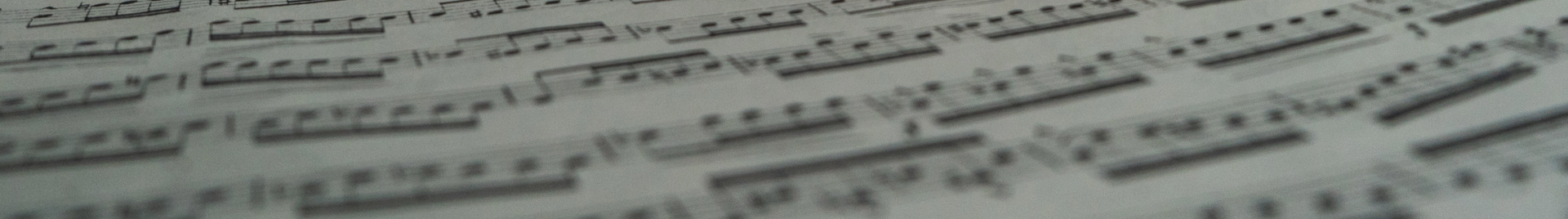

Jörg Schnepel
Konzert für Gitarre und Orchester
Kurz-Instrumentierung: 1 1 1 1 - 0 0 0 0, mar, str
Dauer: 26'
Solisten:
guitar
Instrumentierungsdetails:
Flöte
Oboe
Klarinette in B
Fagott
Marimbaphon
Violine I (6 Spieler)
Violine II (4 Spieler)
Viola (4 Spieler)
Violoncello (2 Spieler)
Kontrabass
Konzert für Gitarre und Orchester
Gedruckt/Digital
Übersetzung, Abdrucke und mehr

Jörg Schnepel
Gitarre (Konzert für Gitarre und Orchester)Ausgabeart: Solostimme(n)
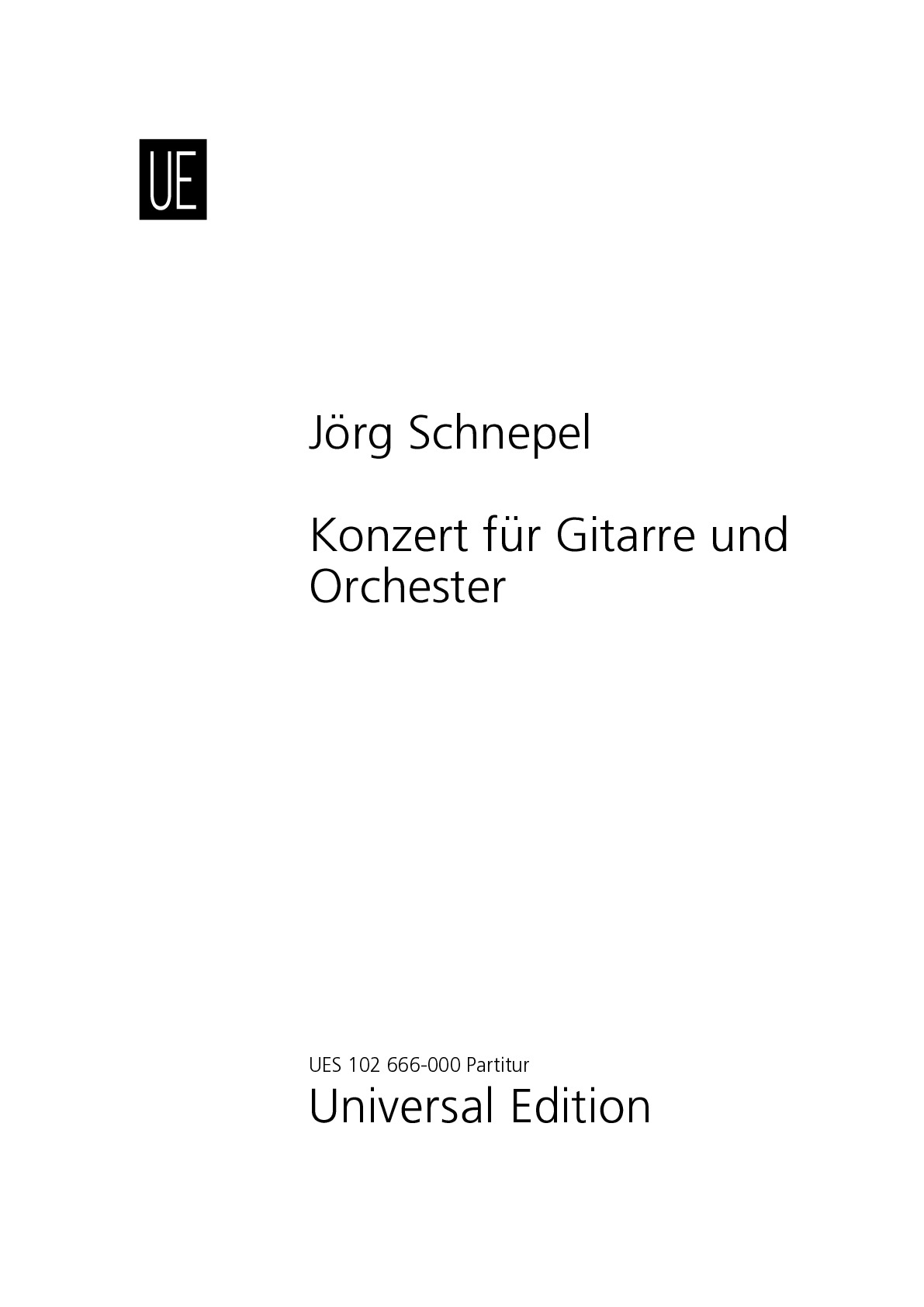
Jörg Schnepel
Konzert für Gitarre und OrchesterAusgabeart: Dirigierpartitur
Musterseiten
Hörbeispiel
Werkeinführung
Konzert für Gitarre und Orchester
Im Jahre 2013 konnte ich meinen lange gehegten Wunsch in die Tat umsetzen, für "mein Instrument" - die Gitarre - ein Konzert zu schreiben. Insbesondere galt damals mein Interesse dem Soloinstrument ein Orchester entgegen zu stellen, das seinem Namen gerecht wird: so fügen sich den obligatorischen Streichern vier Solo-Holzbläser hinzu. Darüberhinaus sorgt die Hinzunahme des Marimbaphons für reizvolle klanglich-rhythmische Akzentuierungen. Doch durfte das Instrumentarium nicht zu umfangreich sein, damit die dynamische Balance sich nicht ungünstig für die Gitarre auswirken kann. Von daher konnte das Blechblasinstrumentarium leider keine Verwendung finden.
Der erste Satz - ein straffes Allegro risoluto - zeigt alle Merkmale, die man allgemein von einem Konzertsatz erwarten darf: sowohl die Gitarre als auch die Orchesterstimmen entwickeln den Satz mit immer neuen Materialien, wobei die Musik keinesfalls "kopflastig" erscheint, sondern den Interpreten oft die Möglichkeit gibt, das Spiel glanzvoll und mit
Bravour zu gestalten.
Nehmen die Orchesterstimmen einen dem Soloinstrument gegenüber gleichwertigen Rang ein, so ist diese "Demokratisierung" des Instrumentariums wohl der markanteste Unterschied gegenüber den Konzerten der klassischen Epoche um Mauro Giuliani, Ferdinando Carulli oder Francesco Molino, in denen das Orchester oft nur eine begleitende Funktion besitzt.
In der Folge sind die Orchester-tuttis wohl dosiert und aus der musikalischen Entwicklung völlig natürlich erlebbar, so dass es über weite Strecken des Konzertes zu immer neuen, mehr kammermusikalischen Instrumentierungen, kommt. Diese farbenreiche Organisation des musikalischen Satzes ist besonders im Kopfsatz des vorliegenden Konzertes zu erleben. Dagegen sind die solistischen Einsätze der Gitarre vergleichsweise seltener und vor allem kürzer gefasst.
Der zweite Satz ist eine breit ausströmende Canzone in polyphoner Struktur, wie wir es aus der Blütezeit des mittleren 16. Jahrhunderts kennen. Jedoch sind die Streicherstimmen zu Beginn in konsequenter Reihentechnik durchweg dodekaphonisch durchgearbeitet. Das Studium der Partitur und erst recht das Hören dieser Musik machen deutlich, dass das Orchester zunehmend sinfonischer angelegt erscheint. Allein die orchestrale Introduktion mit 46 großen Takten im 4/2 Takt erzeugt einen erheblichen klanglichen Kontrast gegenüber dem ersten Satz. Diese annähernd sakrale Weite spiegelt sich durch die Verwendung der verschiedensten polyphonen Strukturen, wie Imitation, Kanon, Fuge, freier Kontrapunkt bis hin zur Zehnstimmigkeit, wobei gerade im zweiten Volltutti in f-moll ein spätromantischer Einschlag anklingt. Doch das Schlusswort dieses Satzes erhält die Gitarre mit dem erneuten Beginn des anfänglichen Tonmaterials, welches freilich sehr abgewandelt wird und den Satz mit den Streichern und Holzbläsern nachdenklich-empfindsam in cis-moll und im ppp beschliesst.
Der dritte Satz wurde erst vier Jahre später angegangen, dann aber in kurzer Zeit fertig gestellt. Dem Ausformulieren des musikalischen Materials wird nun mehr Zeit und Raum gegeben. Die melodische Linie ist mehr und mehr chromatischer gestaltet, verliert die tonale Gebundenheit und gewinnt an individueller Freiheit. Das harmonische Geschehen ist nun deutlich vielschichtiger angelegt und die Rhythmik wird akzentuierter und konfliktreicher. In konzentrierter Form sind diese stilistischen Unterschiede gegenüber den zwei vorherigen Sätzen besonders im Interludium I wahrzunehmen: ein ausgedehntes Quintett von Flöte, Marimbaphon, Gitarre, Viola und Kontrabass. Das zweite Kernstück dieses Satzes ist die umfangreiche Cadenza der Gitarre, in welcher neben freien, rhapsodischen Abschnitten, thematisch auf den ersten und zweiten Satz rückbezogen wird. Nur noch ein kurzes Schlusstutti ist für den Abschluss der Komposition nötig.
Bei allen stilistischen Unterschiedlichkeiten des 1. und 2. Satzes gegenüber dem 3. Satz, ist aus meiner Sicht dieser Umstand eher als Gewinn an Vielseitigkeit zu bewerten, weniger als Verlust an Homogenität.
Die zeitliche Ausdehnung dieses Konzerts für Gitarre und Orchester ist mit ca. 26 Minuten Spielzeit recht üppig ausgefallen. Der Schwierigkeitsgrad bezüglich der musikalischen Umsetzung, namentlich für die Gitarre, ist über weite Strecken als moderat zu bezeichnen, was nicht selbstverständlich ist!
Möge dies auch dazu beitragen, diesem Konzert einen breiteren Zugang in der Öffentlichkeit zu ermöglichen.
Jörg Schnepel, 01. Juni 2022
