
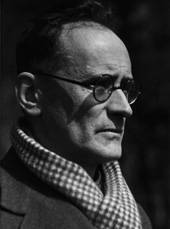
Anton Webern
Passacaglia
Kurz-Instrumentierung: 1 1 1 1 - 1 0 1 0 - Schl, Vib, Synth, Vl, Va, Vc, Kb
Dauer: 11'
Bearbeitet von: Henri Pousseur
Instrumentierungsdetails:
Flöte (+Picc)
Oboe
Klarinette in B
Fagott
Horn in F
Posaune
Vibraphon (+Xylorimba)
Schlagzeug
Synthesizer
Violine
Viola
Violoncello
Kontrabass
Webern - Passacaglia für kleines Ensemble
Musterseiten
Werkeinführung
Am Ende seiner vierjährigen
Lehrzeit bei Arnold Schönberg schrieb Anton Webern dieses – wie er selbst es
nannte – „Gesellenstück“. Das Werk ist durch die sichere Handhabung des
gewaltigen, spätromantischen Orchesterapparates, die klare und überzeugende
Disposition des immerhin 269 Takte umfassenden Satzes (somit des längsten unter
Weberns autorisierten Kompositionen) und die meisterhafte Beherrschung der
Kompositionstechnik als op. 1 in der
Musikgeschichte wohl beispiellos. Die Komposition ist freilich nicht nur ein
Beweis der mit dem Abschluss der Lehre bei Schönberg erworbenen technischen
Fertigkeiten Weberns, sondern das erste vollgültige Zeugnis für seinen
originellen Umgang mit der musikalischen Tradition. Die Passacaglia, eine im
Barock beliebte, dem beginnenden 20. Jahrhundert vor allem durch J. S. Bach und
Brahms (Haydn-Variationen, IV. Symphonie) vertraute Form, besteht aus
Variationen über ein ostinat wiederkehrendes Modell im Dreiertakt, häufig der Bass
der Komposition. Wie ein gleichmäßiger weiter Pendelschlag durchpulst der
Achttakter von Weberns Passacaglia-Thema (im Zweiertakt!), zu Beginn von den
Streichern unisono im ppp pizzicato vorgetragen, das gesamte Werk, nur gegen Schluss
durch metrische Erweiterungen leicht gestört. Das Thema selbst aber verliert
sich für den Hörer im Verlauf der Komposition immer mehr. Seine melodischen
expressiven Ableitungen und Motive, die aus der Gegenstimme der Flöte in der 1.
Variation entwickelt werden, drängen sich in den Vordergrund und bestimmen das
in drei großen Steigerungswellen ablaufende, von starken Tempomodifikationen
geprägte Geschehen. Die durch exzessive Chromatik und auskomponierte
Nebenstufen erweiterte Tonalität des Werkes wirkt wie eine Reminiszenz, nicht
als selbstverständliches Organisationsprinzip, sondern als bewusst
rückwärtsgewandtes Als-ob. Der objektive Zug von Trauer und Wehmut, den das
Werk vermittelt, mag auch damit in Zusammenhang stehen. Die – auch späterhin
für Webern charakteristische – solistische Führung der Instrumente, die häufig
vorgeschriebene Dämpfung der Blechbläser und Streicher wie das rhythmische
Gegeneinander von Zweier- und Dreiertakt tragen des weiteren zum gebrochenen
Gesamteindruck bei.
1922 schrieb Webern für eine
Aufführung in Düsseldorf die folgende Analyse: „Die Streicher pizzikieren
unisono das Hauptthema. Es folgen 23 Variationen und eine durchführungsartige
Coda. Die erste Variation bringt die grundlegende Harmonisierung des
Hauptthemas und ein Gegenthema. Damit sind die beiden Grundgestalten des
Stückes gegeben. Alles was folgt ist von diesen abgeleitet. So stellt sich
gleich in der 2. Variation die Melodie der Klarinette als eine Umbildung des
Gegenthemas dar. Sie wird zum Thema der Variationen 3 bis 5 und zu einem der
wichtigsten Faktoren des weiteren Verlaufes. Das Letztere gilt auch von einer
aus dem Hauptthema gebildeten Gestalt, die in der nächsten (6.) Variation
auftritt. Ihr entspringt in der folgenden (7.) Variation ein Thema im Allegrotempo.
In der 8. Variation erklingen gleichzeitig: die Urform des Hauptthemas
(Violinen), eine nun oft wiederkehrende Umbildung der [in Variation 6 erstmals
aufgetretenen] Gestalt (Bässe) und im Blech eine Variation des Gegenthemas,
welche thematisch von großer Bedeutung wird. Die Variationen 8 bis 11 leiten zu
den D-dur-Variationen über und verarbeiten die in der 8. gebildeten Motive und
Kombinationen. Die erste Dur-Variation hat einleitenden Charakter. In der
zweiten erscheint ... die Melodie [aus Variation 3] in neuer Form, womit das
Thema der dritten und vierten Dur-Variation gegeben ist. Die noch folgenden
acht Mo 11-Variationen bauen sich in kanonischen und imitatorischen Bildungen
auf einer Veränderung des Hauptthemas auf. Den Gipfel der hier stattfindenden
Steigerung bildet die letzte (23.) Variation, welche eine Wiederholung der
achten in veränderter Form darstellt. Die Coda beginnt, als Einleitung eine
Mollform der ersten Dur-Variation benutzend, in der Haupttonart, verläßt sie
hierauf und verarbeitet durchführungsartig das in der zweiten Dur-Variation
aufgestellte Thema. In geradliniger Steigerung führt es zu einer veränderten
Wiederholung der 7, Variation. Gestalten aus der 8. beschließen das Stück.“
Manfred Angerer
