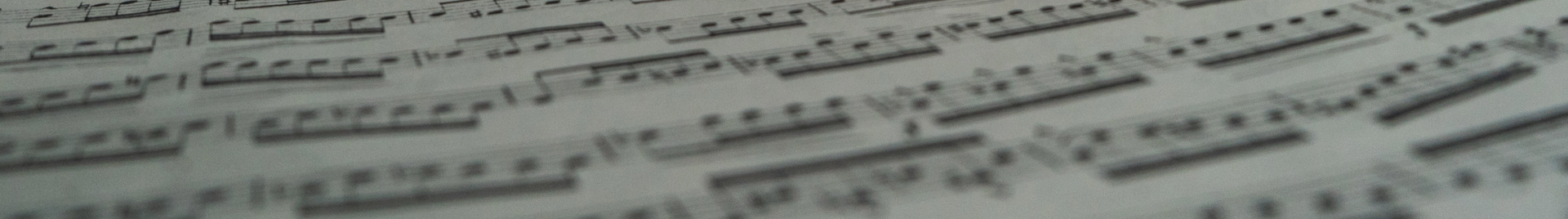

Richard Wagner
Siegfried
Kurz-Instrumentierung: 2 3 3 3 - 4 2 4 1 - Pk, Schl(2), Hf, Klav, Str(10 8 6 5 4)
Dauer: 240'
Bearbeitet von: Eberhard Kloke
Rollen:
Siegfried (Tenor) Mime (Tenor) Wanderer (Bariton/Bassbariton) Alberich (Bariton/Bassbariton) Fafner (Bass) Brünnhilde (Sopran) Erda (Alt) Waldvogel (Sopran)
Instrumentierungsdetails:
1. Flöte (+Picc)
2. Flöte (+Picc
Afl(G))
1. Oboe
2. Oboe (+Eh)
3. Oboe (+Eh, Hph)
1. Klarinette in B (+Kl(A))
2. Klarinette in B (+Kl(A), Bkl(B))
3. Klarinette in B (+Kl(A), Bkl(B), KbKl(B))
1. Fagott
2. Fagott
3. Fagott (+Kfg)
1. Horn in F (+Wgtb in B)
2. Horn in F (+Wgtb in B)
3. Horn in F (+Wgtb in F)
4. Horn in F (+Wgtb in F)
1. Trompete in C
2. Trompete in C
1. Tenorbassposaune (+Btrp in C)
2. Tenorbassposaune
3. Tenorbassposaune
4. Tenorbassposaune (+Kbpos)
Kontrabasstuba
Pauken
Schlagzeug(2)
Harfe
Klavier (+Cel)
Violine I(10)
Violine II(8)
Viola(6)
Violoncello(5)
Kontrabass(4)
Wagner - Siegfried für mittelgroßes Orchester
Musterseiten
Werkeinführung
Siegfried ist neben Rheingold das experimentellste Werk von Wagners Ring-Opern. Die große zeitliche Unterbrechung der Kompositionsarbeit an Siegfried brachte 2 wesentliche Aspekte zum Vorschein, die in der Folge Auswirkung auf Klang, Klangarchitektur und generell kompositorische Verdichtung im Werk hatten:
1. Entstehung von Tristan und Meistersinger
2. Konkretisierung der Festspielidee und Planung des Bayreuther Festspielhauses („verdeckter Orchesterklang“).
Es sei immer wieder darauf hingewiesen, dass Siegfried erst ab dem 3. Akt im Hinblick auf die besonderen akustischen Verhältnisse des Bayreuther Festspielhauses (verdeckten Orchestergraben – „mystischen Abgrund“) konzipiert wurde.
Die vorliegende Bearbeitung von Siegfried zielt auf spezielle Klanggewichtungen der einzelnen Akte:
Generell bestand Instrumentierungsarbeit darin, zwischen Klangverdichtung und Ausdünnung das richtige Verhältnis zu suchen und gleichzeitig die Klangbalance zwischen Sänger (Szene) und Orchester (Musik) neu zu gewichten.
Vor allem galt es, die instrumentalen Verdopplungen zu minimieren, um den Klang „zu entfetten“ und ihm das „Dröhnen“ zu nehmen. Des Weiteren zielte die Instrumentierung auf ein spezielle Ausdifferenzierung von Holz- und Blechbläserklangfarben, siehe Englischhorn, Heckelphon, Bassklarinette, Kontrabassklarinette und Kontrafagott sowie Basstrompete, Wagnertuben und Kontrabassposaune. Hinzu kamen neue Dynamisierungen, um den Gesangsstimmen eine differenzierte Sprach- und Gesangsnuancierungsmöglichkeit zu geben und um den Orchesterklang weiter auszubalancieren.
Spezifika der einzelnen Akte:
1. Der erste Akt hat mit Xylorimba, Klavier und Harfe eine schärfere Akzentuierung in Richtung auf das „Maschinelle“, der Produktion in der Schmiede. Gleichzeitig wurde dabei auch dem Streit zwischen Siegfried und Mime ein schärfer akzentuiertes Klangbild gegeben, die zweite Szene wurde schlanker und damit in vielen Passagen mit kammermusikalischer Klanggeste versehen. Strukturell weist dieser Akt schon auf die Leichtigkeit und Lebendigkeit der Meistersinger, siehe die Vorschläge, Triller und Wechselnoten.
2. Der zweite Akt moduliert die großen Klanggeheimnisse der Fafner-Szenen und bringt schärfere Kontraste in den Alberich-Passagen, um in der Waldvogel-Episode in ein kammermusikalisches Kontrastbild zu münden. Die Alberich-Wotan-Passagen knüpfen sowohl an die entsprechenden Passagen aus der Walküre bzw. Siegfried I als auch die Mime-Passagen an Siegfried I.
3. An der Bruchstelle vom zweiten auf den dritten Akt erscheint der Kontrast zwischen den kammermusikalischen Naturszenen (Waldvogel) des 2. Aktes und den gewichtigen, unheilvollen Tuttiklängen des Vorspiels zum 3. Akt (siehe Walküre „Unruhemotiv“) besonders markant. Wie in Walküre kommt in Siegfried (siehe „Weltbegrüßung“) ab dem dritten Akt wieder die Celesta zum Einsatz, auf den Klavierklang wurde ab 2. Akt zunehmend verzichtet. Der dritte Akt nimmt das Nachbeben des Tristan in sich auf und erweitert die Klangpalette der Orchesterfarben.
Auf drei instrumentatorische Besonderheiten sei hingewiesen:
a) Bei Ziff. 51 ist die „ewige Melodie“ der hohen Streicher geerdet mit einem Orgelpunkt „a“ der Kontrabassklarinette.
b) Nach Ziff. 65: um die finale Wirkung der Dominante vor dem Weltbegrüßungsthema zu verstärken, löst sich die Pauke von der Basslinie. Dieses Verfahren verwendete Wagner zum ersten Mal im Lohengrin-Vorspiel, wo gegen Ende die Pauke einen harmonie-fremden Ton spielt, um in der Folge mit Erreichen des Grundtons die harmonische Bestätigung zu überhöhen.
c) Siegfried-Idyll nach Ziff. 93: in die instrumentalen Farben sind wenige Original-Motive aus Wagners Siegfried-Idyll quasi als musikalische Reminiszenzen eingefügt.
Besetzung Siegfried
Auf die konkrete Stimmfachbezeichnung wurde verzichtet, da mit dieser Bearbeitung das Werk auch mit leichteren Stimmen – nicht speziell auf hochdramatisch bezogene Fächer tradierter Art – besetzt werden kann.
Siegfried: Tenor
Mime: Tenor
Wanderer: Bariton, Bassbariton
Alberich: Bariton, Bassbariton
Fafner: Bass
Brünnhilde: Sopran
Erda: Alt
Waldvogel: Sopran
Orchester-Besetzung: 60 Instrumentalisten/Innen
Gewidmet MKD
Eberhard Kloke
Eine Broschüre mit detaillierten Informationen zur Bearbeitung und Besetzung (Besetzungsüberschneidungen und Doppelbesetzungsoptionen) ist bei Universal Edition erhältlich: [email protected]
