
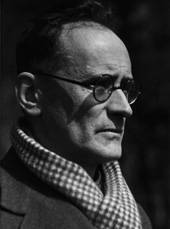
Anton Webern
Streichquartett
Dauer: 9'
Widmung: Frau Elizabeth Sprague Coolidge zugeeignet
Instrumentierungsdetails:
1. Violine
2. Violine
Viola
Violoncello
Webern - Streichquartett für Streichquartett
Übersetzung, Abdrucke und mehr

Anton Webern
Webern: Quartett für Streichquartett - op. 28Instrumentierung: für Streichquartett
Ausgabeart: Stimmensatz
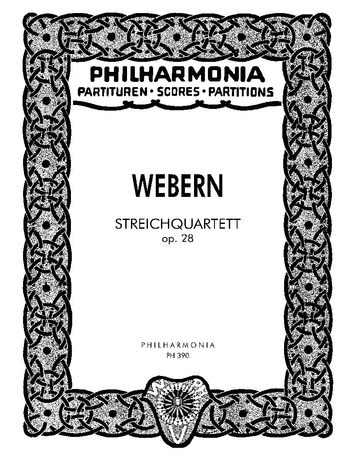
Anton Webern
Webern: Streichquartett für Streichquartett - op. 28Instrumentierung: für Streichquartett
Ausgabeart: Taschenpartitur
Hörbeispiel
Werkeinführung
Sein letztes Streichquartett
komponierte Webern 1937/38. Am 12. März 1938, dem Tag des Einmarsches Hitlers
in Österreich, schrieb er an das Ehepaar Jone-Humplik: „Ich bin ganz in meiner
Arbeit und mag, mag nicht gestört sein.“ Es entstand ein Werk von einer selbst
bei Webern beispiellosen Konzentration des Ausdrucks und der
Kompositionstechnik. Adorno sprach gar von „Reihenfetischismus“ und
„Versimpelung der Musik“. Allerdings prägt die besonders komplex entworfene
Reihe die Struktur der Komposition bis ins letzte Detail. Die wichtigsten
Relationen sind die folgenden: Die Reihe gliedert sich in drei Viertongruppen,
die erste und dritte sind das berühmte BACH-Motiv, die zweite dessen Umkehrung.
Gleichzeitig zerfällt sie in zwei Sechstongruppen, deren zweite die
Krebsumkehrung der ersten bildet. Der erste, siebenteilige Satz, durch
Tempomodifikationen und unterschiedliche Dichte des kontrapunktischen Satzes
gegliedert, bringt immer wieder neue Kombinationen der zentralen Viertongruppe.
Webern schreibt darüber 1939 in einer umfangreichen Analyse für Erwin Stein:
„Der I. Satz ist ein Variationen-Satz; aber mit den Variationen ist auch eine
Adagio-Form gegeben und das primär. D.h. diese liegt dem Satz in der formalen
Konstruktion zu Grunde und dementsprechend sind die Variationen geworden.“ Der
zweite Satz, eine „Scherzo-Miniatur“ (Webern), ist klar dreiteilig gegliedert.
Ein pizzicato vorgetragener vierstimmiger Umkehrungskanon kontrastiert mit
einem bewegten expressiven Mittelteil (arco). Über den dritten Satz schrieb
Webern: „Er soll innerhalb des Werkes sozusagen die ,Krönung’ der auch schon in
1. und 2. angestrebten ,Synthese’ von ‚horizontaler’ und ‚vertikaler’
Darstellung sein. Wie bekannt, erwuchsen auf der Basis der ersteren die Formen
des klassischen Cyklus, Sonate, Symphonie u.s.f., auf der zweiten die ‚Polyphonie’
und die mit dieser gegebenen Formen, Canon, Fuge u.s.w. Und nun versuchte ich
hier nicht nur allgemein die Gesetzmäßigkeit beider zu erfüllen, sondern im
besonderen die Formen direkt zu verbinden ... Primär gegeben ist eine ‚Scherzo’-Form,
mit ihr also Thema-Durchführung-Reprise. In dieser Hinsicht waren die
Gesetzmäßigkeiten der ‚horizontalen’ Darstellungsart maßgebend. Aber die ‚Durchführung’
stellt eine Fuge dar, deren 3. ‚Durchführung’ die Reprise des Scherzo-Themas,
Erfüllung der Scherzo-Form ist!“ Webern unternahm also in der traditionell
hochgeachteten Streichquartettbesetzung den Versuch, Fugen- und Sonatenform,
polyphone und homophone Konzeptionen zu vereinigen, ein Ideal, das seit der
Wiener Klassik, zumal seit Beethoven, immer wieder Komponisten zu realisieren
gesucht hatten. Das BACH-Motiv erhält so, neben seiner konstruktiven Funktion,
eine besondere ideelle Bedeutung.
Manfred Angerer
