
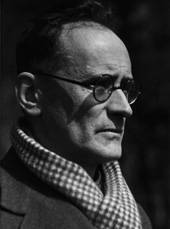
Anton Webern
Streichtrio
Dauer: 9'
Webern - Streichtrio für Geige, Bratsche und Violoncello
Übersetzung, Abdrucke und mehr
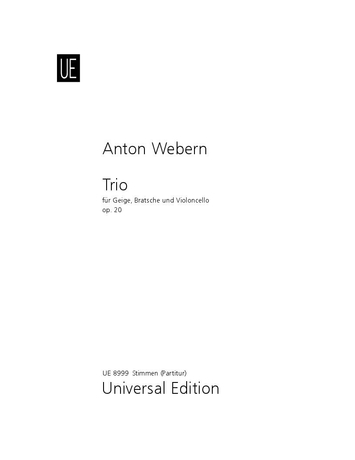
Anton Webern
Webern: Streichtrio für Streichtrio - op. 20Instrumentierung: für Streichtrio
Ausgabeart: Stimmensatz
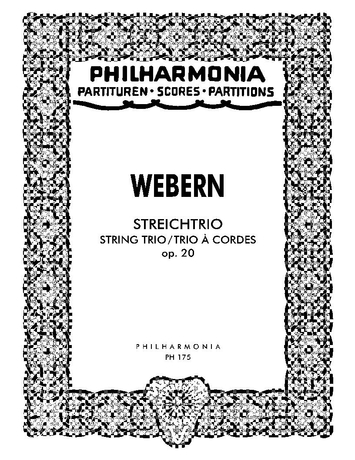
Anton Webern
Webern: Streichtrio für Streichtrio - op. 20Instrumentierung: für Streichtrio
Ausgabeart: Taschenpartitur
Hörbeispiel
Werkeinführung
Nach 13 Jahren wandte sich Webern mit diesem 1927 vollendeten Streichtrio wieder der Komposition größerer Instrumentalwerke zu. Webern steht hier vor dem Problem, ohne die Hilfe Zusammenhang stiftender Texte Musik komponieren zu wollen, die über die Aneinanderreihung von Kurzmotiven oder athematischen Floskeln hinaus die Gestaltung eines größeren musikalischen Ablaufs sinnvoll ermöglicht. Um dies erreichen zu können, verbindet Webern seine elaborierte dodekaphone Kompositionstechnik mit tradierten Formmodellen der klassisch-romantischen Musik. Der erste (langsame) Satz ähnelt einem Sonatenrondo (dreiteiliger Hauptteil, Seitensatz mit variierter Wiederholung, stark veränderte Reprise des Hauptteils), der zweite ist ein Sonatensatz mit langsamer Einleitung. Der Nachvollzug dieser vertrauten Schemata wird dem Hörer freilich durch die extreme Variationstechnik, die starke Verfremdung des Streicherklanges (Flageolett, pizzicato, am Steg, riesige Intervalle) und die dichte Kontrapunktik nahezu unmöglich gemacht. Weberns Stil hat hier den äußersten Grad an Komplexität erreicht. Wie verwirrend das Werk auf – wohlmeinende – Zeitgenossen gewirkt haben mag, kann man einer Kritik der Wiener Uraufführung im Jahre 1928 mit Mitgliedern des Kolisch-Quartetts in der „Deutschen Allgemeinen Zeitung“ entnehmen: „Reich schattenhafter Visionen, seltsam unheimlicher innerer Gesichte – es ist ein Angsttraum der Musik. Die Kunst, mit der das alles gestaltet ist, bleibt aufs höchste zu bewundern, aber man fragt sich, beinahe erschreckt, danach, wie ein Gehirn organisiert sein muß, das solcher Eingebungen fähig ist. Man scheut sich, das Wort ‚abnorm’ auszusprechen angesichts eines Werkes, das die künstlerischen Kapazitäten seines Schöpfers so zweifelsfrei beweist, aber man kann andererseits auch nicht behaupten, daß in diesem Trio Weberns irgendwelche Beziehungen zu unseren gewohnten Vorstellungen von Musik zu finden sind.“ So steht das Werk an der Grenze zwischen dem expressiven, nach Ausdruck ringenden atonalen Frühwerk und den späteren, vor allem um die schlüssige Organisation des Materials bemühten Kompositionen. Die Anlehnung an alte Formen bereitet jene „kühle“ Ordnung vor, die das „innere Leuchten“ der Tonbeziehungen der Reihe aufzeigen und kenntlich machen will. Die „überhitzte“ Tonsprache des Trios musste diese Tendenzen, den radikalen Bruch mit grundlegenden Konventionen der traditionellen Ausdrucksmusik, nur fühlbarer werden lassen.
Manfred Angerer
