

Alban Berg
Wozzeck
Kurz-Instrumentierung: 4 4 5 4 - 4 4 4 1 - Pk(2), Schl(4), Hf, Cel, Str; Bühne: Heurigenmusik - Fiedel (2-4), Kl, Akk, Git, Btb; Militärmusik - 3 2 2 2 - 2 2 3 1 - Schl; Pianino; KammOrch - 1 2 3 2 - 2 0 0 0 - Str(1 1 1 1 1)
Dauer: 90'
Übersetzer: Vida Harford, Eric Blackall
Dichter der Textvorlage: Georg Büchner
Libretto von: Alban Berg
Widmung: Alma Maria Mahler zugeeignet
Chor: Soldaten und Burschen, Tenor I u. II, Bariton I u. II und Baß I u. II
Mägde und Dirnen, Soprane und Alte (zweistimmig)
Kinder (einstimmig)
Solisten:
Bariton, Sprecher
Rollen:
Wozzeck: Bariton und Sprechstimme
Tambourmajor: Heldentenor
Andres: lyrischer Tenor und Sprechstimme
Hauptmann: Tenorbuffo
Doktor: Baßbuffo
1. Handwerksbursch: tiefer Baß und Sprechstimme
2. Handwerksbursch: hoher Bariton
Der Narr: hoher Tenor
Marie: Sopran
Margret: Alt
Mariens Knabe: Singstimme
ein Soldat: Tenor
Instrumentierungsdetails:
1. Flöte (+Picc)
2. Flöte (+Picc)
3. Flöte (+Picc)
4. Flöte (+Picc)
1. Oboe
2. Oboe
3. Oboe
4. Oboe (+Eh)
1. Klarinette in B (+Kl(A))
2. Klarinette in B
3. Klarinette in B (+Kl(Es))
4. Klarinette in B (+Kl(Es))
Bassklarinette in B
1. Fagott
2. Fagott
3. Fagott
Kontrafagott
1. Horn in F
2. Horn in F
3. Horn in F
4. Horn in F
1. Trompete in F
2. Trompete in F
3. Trompete in F
4. Trompete in F
1. Altposaune
2. Tenorposaune
3. Tenorposaune
4. Bassposaune
Kontrabasstuba
Pauken (2 Spieler)
Schlagzeug (4 Spieler)
Celesta
Harfe
Violine I
Violine II
Viola
Violoncello
Kontrabass
Bühne (Militärmusik): kleine Flöte
1. Flöte
2. Flöte
1. Oboe
2. Oboe
1. kleine Klarinette in Es
2. kleine Klarinette in Es
1. Fagott
2. Fagott
1. Horn in F
2. Horn in F
1. Trompete in F
2. Trompete in F
1. Posaune
2. Posaune
3. Bassposaune
Kontrabasstuba
Schlagzeug
Bühne (Heurigenmusik): 1. Fiedel
2. Fiedel
1. Fidel (transponiert)
2. Fidel (transponiert)
Klarinette in B
Klarinette in C (alternativ statt Klar. in B)
Akkordeon
Gitarre
Basstuba
auf der Bühne: verstimmtes Pianino
Bühne (Kammerorchester): Flöte (+Picc)
Oboe
Englischhorn
kleine Klarinette in Es
Klarinette in A
Bassklarinette in B
Fagott
Kontrafagott
1. Horn in F
2. Horn in F
Violine I (1)
Violine II (1)
Viola (1)
Violoncello (1)
Kontrabass (1)
Berg - Wozzeck
Gedruckt/Digital
Übersetzung, Abdrucke und mehr
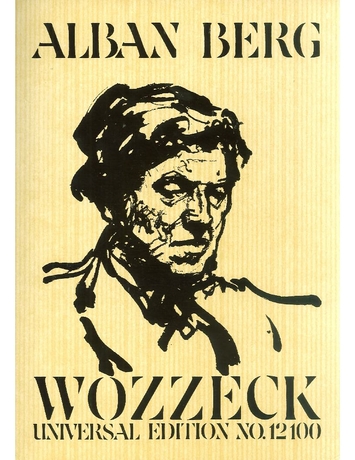
Alban Berg
Berg: Wozzeck - op. 7Ausgabeart: Studienpartitur
Sprache: Deutsch | Englisch
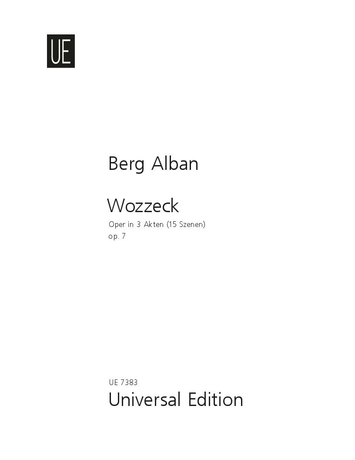
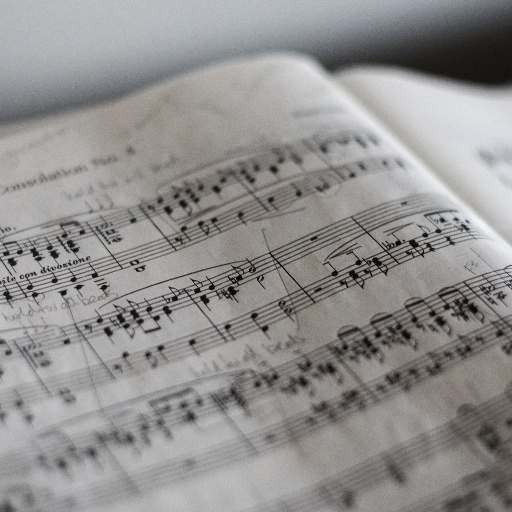

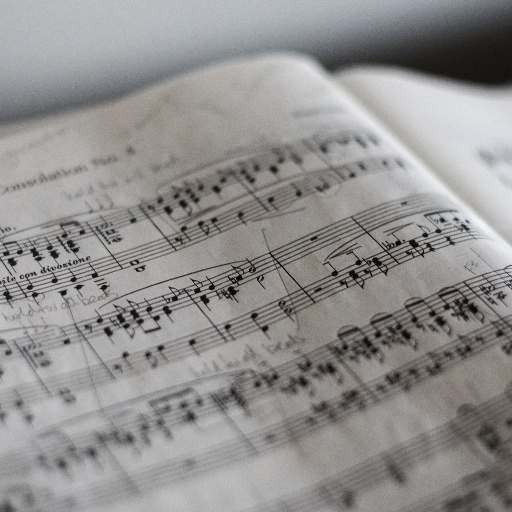
Musterseiten
Hörbeispiel
Werkeinführung
Alban Berg besuchte im Mai 1914 im Wiener Residenztheater die Erstaufführung von Georg Büchners „Woyzeck“. Berg, längst auf der Suche nach einem Opernstoff, war sofort entschlossen, das Stück zu komponieren. Dann brach der Erste Weltkrieg aus und Berg wurde Soldat. Es vollzog sich in diesen Jahren seine Identifikation mit dem Soldaten Wozzeck. „Steckt doch auch ein Stück von mir in dieser Figur, seit ich ebenso abhängig von verhaßten Menschen, gebunden, kränklich, unfrei, resigniert, ja gedemütigt diese Kriegsjahre verbringe“, schreibt er 1918 an seine Frau Helene.
Der Krieg hatte aus dem Ästheten Berg einen sozial Empfindenden gemacht. Ein Opernstoff mit Außenseitern der Gesellschaft wie Wozzeck und seine Marie, die ihm ein Kind geboren hat, „ohne den Segen der Kirche“, ein Text, der an dem Hauptmann, dem Arzt und dem schönen Tambourmajor als Vertretern der Macht unverkennbar Kritik übt.
Alles an dieser Musik schien neu und dabei formal wie emotionell begründet. Die Behandlung von Singstimmen und Orchester war den szenischen Handlungen mit naturalistischer Treue angeglichen. Rezitativ, Arioso und Sprechgesang im Geist des Schönbergschen „Pierrot lunaire“ fanden ihren logischen Platz in der Dramaturgie. Berg hatte von Büchners Szenen fünfzehn ausgesucht und in drei Akte zu je fünf Szenen eingeteilt. Jeder Akt hatte eine durchkomponierte Form, die sich ihrerseits aus traditionellen Formen zusammensetzte. In der Tonsprache verbindet Berg tonale, polytonale und atonale Mittel. Seine epochalen Neuerungen standen also auf dem festen Boden der Tradition.
Die Uraufführung 1925 an der Berliner Lindenoper unter Erich Kleiber war noch sehr umstritten. Berg sollte den endgültigen Triumph seines „Wozzeck“ nicht mehr erleben. Heute ist diese zutiefst humane Oper, die in gewisser Weise auch eine Passionsmusik ist, als Meisterwerk des 20. Jahrhunderts längst im Repertoire angekommen.
Bemerkungen von Alban Berg
Es ist mir nicht im Schlaf eingefallen, mit der Komposition des Wozzeck die Kunstform der Oper reformieren zu wollen. Ebensowenig wie dies Absicht war, als ich sie zu komponieren begann, ebensowenig habe ich je das, was dann entstanden war, für etwas gehalten, was für ein weiteres Opernschaffen – sei es das eigene oder das anderer Komponisten – vorbildlich sein sollte, und auch nicht angenommen oder gar erwartet, das der Wozzeck in diesem Sinne „Schule machen“ konnte.
Abgesehen von dem Wunsch, gute Musik zu machen, den geistigen Inhalt von Büchners unsterblichem Drama auch musikalisch zu erfüllen, seine dichterische Sprache in eine musikalische umzusetzen, schwebte mir in dem Moment, wo ich mich entschloss, eine Oper zu schreiben, nichts anderes, auch kompositionstechnisch nichts anderes vor, als dem Theater zu geben, was des Theaters ist, das heißt also, die Musik so zu gestalten, das sie sich ihrer Verpflichtung, dem Drama zu dienen, in jedem Augenblick bewusst ist – ja, weitergehend: das sie alles, was dieses Drama zur Umsetzung in die Wirklichkeit der Bretter bedarf, aus sich allein herausholt, damit schon vom Komponisten alle wesentlichen Aufgaben eines idealen Regisseurs fordernd. Und zwar all dies: unbeschadet der sonstigen absoluten (rein musikalischen) Existenzberechtigung einer solchen Musik, unbeschadet ihres durch nichts Außermusikalisches behinderten Eigenlebens.
Alban Berg, in Musikblätter des Anbruch, Ausgabe XII, Nr. 2, Jänner 1930
