

David Sawer
Rebus
Kurz-Instrumentierung: 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - Schl, Klav, Str(1 1 1 1 1)
Dauer: 15'
Instrumentierungsdetails:
Flöte
Oboe (+Eh)
Klarinette in B (+Bkl(B))
Fagott (+Kfg)
Horn in F
Trompete in B
Posaune
Tuba
Schlagzeug(1 Spieler: Marimbaphon, Glockenspiel, Vibraphon, Guiro, 2 Wood Blocks, 3 Temple Blocks, Triangel, Sizzle Becken, Hängebecken, Tam Tam, 2 Bongos, Tom Tom, Log Drum, kleine Basstrommel)
Klavier
1. Violine(1)
2. Violine(1)
Viola(1)
Violoncello(1)
Kontrabass(1)
Sawer - Rebus für 15 Spieler
Übersetzung, Abdrucke und mehr
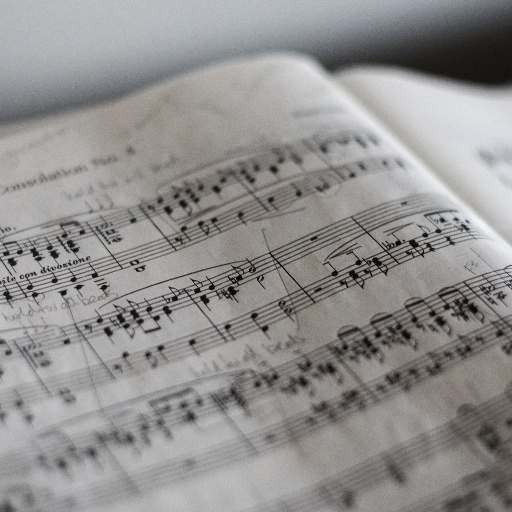
David Sawer
Sawer: RebusInstrumentierung: für 15 Spieler
Ausgabeart: Studienpartitur (Sonderanfertigung)
Musterseiten
Hörbeispiel
Werkeinführung
"De rebus quae geruntur" ("über Dinge, die geschehen") nannte man nach einer alten studentischen Tradition die Darstellung aktueller Ereignisse in Bilderrätseln. Auf den auch heute noch gebräuchlichen Begriff 'Rebus' als Bezeichnung für solche Rätsel, in denen Sätze oder Sprichworte aus zusammen gestellten Bildern, Zeichen, Buchstaben, Silben oder Zahlen zu erraten sind, verweist der Titel von David Sawers neuem Werk für die musikFabrik.
Sawer entwickelt die einsätzige Form aus Wiederholungen und schrittweisen Transformierungen winziger melodischer Einfälle. Wie in einem Puzzle setzen sich kleine melodisch-rhythmische Bausteine zu einem übergeordneten Ganzen zusammen, verdichten sich vereinzelte, fragmentarische Zellen zu melodisch, rhythmisch und dynamisch artikulierten Motiven, die sich innerhalb des Stimmengefüges einander komplementär ergänzen. Im Verlauf des Stückes wandelt sich dabei stetig die klangliche Oberfläche. Durch variierende instrumentale Kombinationen verändert sie ihre Farblichkeit, während die aus wenigen Tönen zusammengesetzten Motive permanenten Verwandlungsprozessen unterworfen sind und sich zu immer neuen Mustern umordnen.
Sawers Vorstellung von objektartigen, räumlich gedachten Klanggebilden scheint hier die strikte Handhabung bestimmter satztechnischer Regeln zu bedingen. So führt er die Stimmen fast ausschließlich paarweise oder im Dreierverbund, wobei die Motive zumeinst konsequent entweder in Gegen- oder aber Parallelbewegung zueinander gesetzt werden. Dem Hörer bietet sich so ein mit horizontalen und vertikalen Motivspiegelungen entwickeltes Geflecht axialsymmetrischer Beziehungen, eine Art akustisches Vexierbild.
© Andreas Günther
