

David Sawer
the greatest happiness principle
Kurz-Instrumentierung: 3 2 3 2 - 4 3 4 1 - Pk, Schl(3), Hf, Str(12 10 8 8 6)
Dauer: 12'
Widmung: to Mark
Instrumentierungsdetails:
Flöte(3)
Oboe(2)
Klarinette(3)
Fagott(2)
Horn(4)
Trompete(3)
Posaune(4)
Tuba(1)
Pauken(1)
Percussion(3)
Harfe(1)
Streicher
Sawer - the greatest happiness principle für Orchester
Gedruckt/Digital
Übersetzung, Abdrucke und mehr
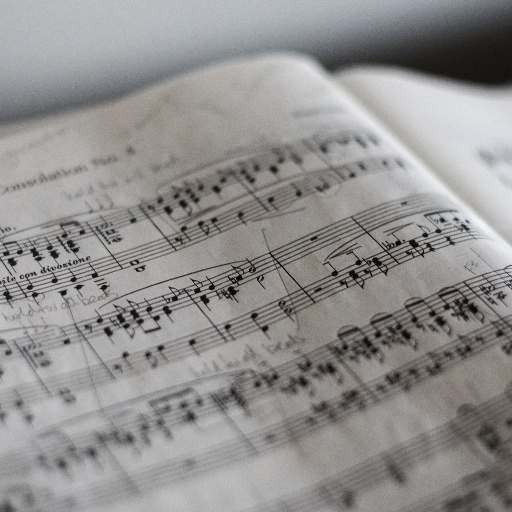
David Sawer
Sawer: The Greatest Happiness PrincipleInstrumentierung: für Orchester
Ausgabeart: Partitur (Sonderanfertigung)
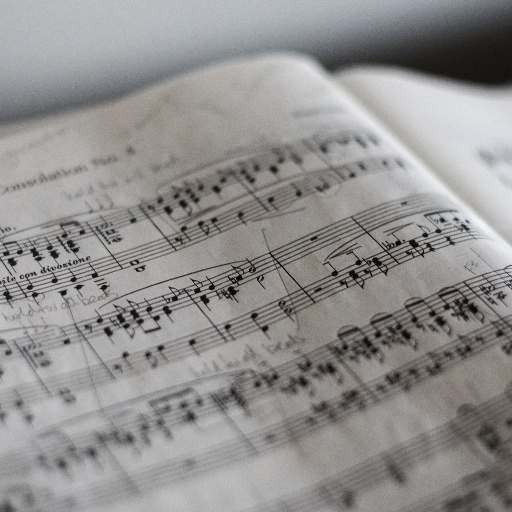
David Sawer
Sawer: The greatest happiness principle für OrchesterInstrumentierung: für Orchester
Ausgabeart: Studienpartitur
Musterseiten
Hörbeispiel
Werkeinführung
Die Tatsache, dass David Sawer bisher immer eine außermusikalische Anregung für seine kreative Vorstellungskraft gebraucht hat, wird besonders verständlich, wenn man seine reichen praktischen Erfahrungen mit dem Theater und seine umfassenden Kenntnisse der bildenden Künste berücksichtigt. Diese Feststellung gewinnt eine zusätzliche Dimension durch die ebenso wichtige Beobachtung, dass Sawers Musik als konzentrierte Erkundung abstrakter musikalischer Prozesse beschrieben werden kann. Die verschiedenen Themen, mit denen sich Sawer auseinandergesetzt hat, umfassen den ersten bemannten Flug (Take Off), eine frühe Form des Dia-Projektors (Cat’s-Eye), ein Bild von de Chirico (The melancholy of departure), den mythologischen Kampf zwischen Herkules und Antaeus (Trompetenkonzert) und Macbeths Vorahnung seines unabwendbaren Untergangs (Byrnan Wood).
the greatest happiness principle bildet keine Ausnahme mit seiner Bezugnahme auf eine außermusikalische Idee, die Sawer faszinierte, als er eine ältere, nunmehr abgebrochene Auftragskomposition in Angriff nahm. Jene Idee schuldete den Umständen der geplanten Erstaufführung seine Existenz.
Zehn Jahre zuvor wurde Sawer nämlich von der Tate Gallery in London um ein neues Werk für Gesang und Klavier gebeten, das im gleichen Konzert mit Messiaens Poèmes pour Mi zur Aufführung kommen sollte. Schon beeindruckt von dem Umstand, dass die Tate Gallery auf den Fundamenten der 'Millibank' Strafanstalt erbaut wurde, stieß Sawer bei seinen Forschungen mit freudigem Erstaunen auf den Namen des Philosophen und Idealisten Jeremy Bentham, den geistigen Vater hinter der geplanten Architektur der Strafanstalt. Bentham wurde von der abstrakten Vorstellung geleitet, dass bei gleicher Verteilung von 'Glück' unter so viele Menschen wie möglich, so etwas wie größtmögliche soziale Harmonie erreicht werden könnte.
Bei der praktischen Realisierung solcher utopischen Träume in einem Gefängnis griff Bentham auf das panoptische Prinzip zurück: die Zellen der Gefangenen wurden kreisförmig um einen zentralen Turm arrangiert, in dem der oder die Wärter ungestörten Überblick über die Gefangene hatten, ohne dass die Gefangenen sich von der Gegenwart der Wärter überzeugen konnten. Alles in allem war dieses Design eine einfallsreich billige und arbeitssparende Form von konstanter Überwachung, und ohne Zweifel eine eindeutige Verbesserung der Lebensbedingungen für die Gefangenen zu Benthams Zeit. Allerdings war dieser Entwurf der größtmöglichen sozialen Harmonie durch konstante - wirkliche oder gefürchtete - Überwachung alles andere als perfekt. Das panoptische (sprichwörtlich: alles sehende) Prinzip des Gefängnisses scheint auf den ersten Blick relativ mild, human und zur Selbsterziehung mahnend im Kontext einer Strafaktion. Aber schon der französische Philosoph Michael Foucoult betonte, dass dieses Prinzip allzu problemlos als soziale Überwachungsmethode einer ganzen Gesellschaft übernommen werden kann, wie es die 'Großen Brüder' unseres Jahrhunderts schon demonstrierten.
Sawer lotet die positiven und negativen Implikationen solchen Denkens in seinem neuen Werk aus. Es ist eine geistreiche Anrufung des "Sentiments der unsichtbaren Allgegenwart", wie Bentham sich selber ausdrückte. Dieses Sentiment artikuliert sich an der Oberfläche als rhythmischer Elan und völlige Transparenz der Texturen sowie durch die bestimmte Klarheit des formalen Aufbaus: die zwölf Minuten enthalten elf Sektionen mit jeweils eigenständigem Material, das sich entlang eines kreisförmigen harmonischen Plans entfaltet, der durch den Quintenzirkel definiert wird. Sawers Behandlung der Instrumente nimmt spezifischen Bezug auf Benthams Strafanstalt. Die Instrumentalisten alias Häftlinge sind dem panoptische Auge permanent ausgesetzt, und wie zufällig folgt die Auswahl der Solo- und Ensemblemomente. In dieser Vielfalt von kammermusikalischer und orchestraler Instrumentation unterscheidet sich the greatest happiness principle von Sawers älterer Orchesterkomposition Byrnan Wood.
Sawers eigene Worte über das Stück enthalten das Wort 'anstreben': "Ich sage nicht, dass es so etwas wie ein Prinzip des größtmöglichen Glücks gibt, oder dass die Musik den Ehrgeiz hat, solcherart darzustellen. Das Stück strebt eine Situation an, die diesem Zustand vielleicht nahe kommt." Eine der Konsequenzen solchen Strebens findet seinen Ausdruck gegen Ende des Stücks.
Antony Bye (Übersetzung aus dem Englischen: Elke Hockings)
