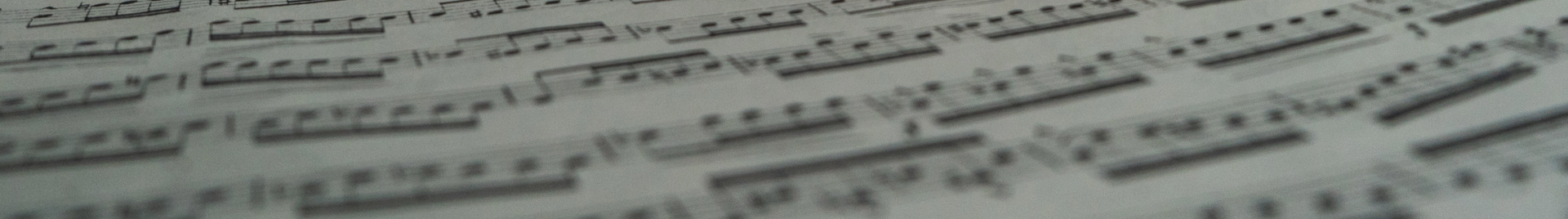
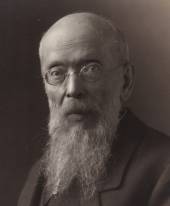
Hans Sommer
*20. Juli 1837
†26. April 1922
Werke von Hans Sommer
Biographie
Sommer wächst nach dem frühen Tod des Vaters (1840)
ab 1845 in Wien, seit 1849 wieder in Braunschweig, in der Familie seines
Stiefvaters, des Kamera-Fabrikanten Peter Wilhelm Friedrich (von) Voigtländer
(1812–1878), auf. Seit ca. 1847 regelmäßiger Klavierunterricht
1854–1858
Mathematikstudium in Göttingen bei u.a. Peter Gustav Lejeune Dirichlet, einem
Schwager Felix Mendelssohns; dort erste Kompositionen und ersten Komposi[-]tions[-]unterricht
beim Schumann-Freund Julius Otto Grimm. Trifft in Göttingen auch mit Johannes
Brahms, Clara Schumann und Joseph Joachim zusammen
Zwischen 1858
und 1876 zahlreiche Veröffentlichungen
zur analytischen Darstellung von Linsen[-]systemen (Fotooptik). Die seinerzeit
weltberühmten Braunschweiger Voigtländer-Werke nutzen ab 1877 Berechnungen
Sommers zur Konstruktion von Fotoobjektiven.
Seit 1859
Lehrer für Mathematik am Braunschweiger Polytechnikum. Daneben regelmässige
Kompositionsstudien bei Wilhelm Meves (1808–1871)
1863–1870
Gründung und künstlerische Leitung des Braunschweiger Vereins für Konzert[-]musik,
veranstaltet Konzerte mit Joseph Joachim, Clara Schumann, Hans von Bülow, Ferdinand
Hiller, Leopold Auer, August Wilhelmj uvm.
1865 UA
des Opernerstlings Der Nachtwächter am Hoftheater Braunschweig
seit 1866
Professor für Mathematik am Braunschweiger Polytechnikum
1875 in
Braunschweig erste Begegnung mit Richard Wagner
1875–1881 Direktor
des Polytechnikums, 1878 Umwandlung in eine der ersten Technischen Hochschulen
Deutschlands
1876 im
Verlag Henri Litolff’s Herausgabe von fünf Klavierliedern als op. 1. Besuch der
ersten Bayreuther Festspiele. Einladungen nach Wahnfried
1884 radikale
Beendigung der naturwissenschaftlichen Karriere. Kompositionsunterricht in
Weimar bei Franz Liszt. Als Reaktion auf den Unterricht bei Liszt Instrumentation
des sechsteiligen Liedzyklus Sapphos
Gesänge op. 6
seit 1885
als freischaffender Komponist Wohnort zunächst Berlin (1885–1888), dann Weimar
(1888–1898)
1885
Heirat mit Antonie Hill (1854–1904), einer Tochter des Baritons Karl Hill
(1831–1893), 2 Kinder
1885/1886
Vertonung einer Reihe von Eichendorfftexten und Herausgabe zweier Bände Romanzen und Balladen (op. 8/op. 11)
1887
Instrumentation der Ballade Sir
Aethelbert (Felix Dahn) aus op. 11
1891 UA
der Lorelei op. 13 in Braunschweig
1892
Aufführungen der Lorelei unter
Richard Strauss in Weimar
1894 UA der
einaktigen „Konversationsoper“ Saint Foix op. 20 unter Hermann
Levi in München
1898
Rückkehr nach Braunschweig. Zusammen mit Richard Strauss und Friedrich Rösch Gründung
der Genossenschaft Deutscher Komponisten in Leipzig.
1899–1903
Vorsitzender der Genossenschaft Deutscher Komponisten
1901
Herausgabe von fünf Brettl-Liedern
nach Texten von Richard Dehmel, Otto Julius Bierbaum, Gustav Falckh und
Heinrich Leuthold.
1903
Gründung – zusammen mit Richard Strauss und Friedrich Rösch – der
Vorläufergesellschaft der GEMA. Wahl in den Vorstand des Allgemeinen Deutschen
Musikvereins (ADMV)
1904 UA des
Rübezahl op. 36 in Braunschweig
1905
Aufführungen des Rübezahl unter Richard Strauss in Berlin
1912 UA
der letzten Oper Der Waldschratt op. 42 in Braunschweig, Wiederaufnahme
des Saint Foix unter Max von Schillings in Stuttgart
1919–1921
Komposition einer Gruppe von zwanzig Orchesterliedern nach Texten von Johann
Wolfgang von Goethe (Dichtungen von Goethe in Gesängen mit Orchester)
1922
Aufnahme in die Akademie der Künste zu
Berlin. Sommer stirbt an den Folgen eines häuslichen Sturzes.
Über die Musik
Spätromantische Juwelen
Der Braunschweiger Hans Sommer (1837–1922) eroberte mit seinem Liedschaffen ab den 1880er Jahren für rund drei Jahrzehnte einen festen Platz in den Konzertsälen. Hinsichtlich der Entwicklungsgeschichte des spätromantischen Klavierlieds verortete Sommers bislang einziger Biograf Erich Valentin ihn zeitlich unmittelbar vor Hugo Wolf: „In ihm berühren sich – man möchte fast sagen: zum ersten und einzigen Male – die Linien, die von Schumann und Liszt ausgehen.“ Nun erleben seine Lieder eine Renaissance, auch auf CD.
Hans Sommer studierte privat Musik und war als Komponist unter anderem Schüler von Franz Liszt. Er war Vorsitzender (und zusammen mit Richard Strauss der Initiator) der Genossenschaft Deutscher Komponisten (1898–1903). 1875 traf Sommer erstmals mit Richard und Cosima Wagner zusammen, gründete in Braunschweig einen Wagner-Verein und ist in den Folgejahren durchaus zum Künstlerkreis Wahnfrieds zu zählen, suchte aber, wie Sommer selbst in seinen Lebenserinnerungen schrieb, „einer blinden Gefolgschaft“ zu entgehen.
Nachdem er zur radikalen Beendigung einer erfolgreichen naturwissenschaftlichen Karriere (Direktor der Technischen Hochschule Braunschweig) entschlossen war, begann mit Mitte Vierzig(!) Sommers Karriere als freischaffender Kom[-]ponist. Von 1882 an ließ er in schneller Folge bei Henri Litolff’s mehr als einhundert Lieder und Balladen erscheinen, bevor ihn der Achtungserfolg seiner Oper Lorelei (UA 1891), die auch Richard Strauss 1892 in Weimar herausbrachte, als Opernkomponisten etablierte. Mit dem Münchner Bariton Eugen Gura, bekannt für seine Verdienste als früher Interpret der Lieder Hugo Wolfs, und Sommers Schwiegervater Karl Hill, Wagners ersten Bayreuth-Alberich, fanden Sommers Lieder in den Konzertsaal – durch Leo Slezak auch auf Schallplatte – und wurden im Feuilleton diskutiert.
Wie besonders bei den 1886 erschienenen Romanzen und Balladen op. 8/op. 11 evoziert auch bei einigen von starker Dramatik geprägten Liedern der Klaviersatz bereits einen spätromantischen Orchesterapparat, so dass als Konsequenz Sommer Ende 1884 sein wenige Monate zuvor als op. 6 veröffentlichten, sechsteiligen Liedzyklus Sapphos Gesänge im Anschluss an einen kurzen Studienaufenthalt bei Franz Liszt und möglicherweise auf Anregung von jenem orchestrierte (Liszt: „Die Lieder sind freilich sehr dramatisch gehalten aber mit Verstand und Geschmack. Fahren Sie nur so fort!“).
Liszts Rolle als wichtiger Wegbereiter des spätromantischen Orchesterliedes erfährt mit Sapphos Gesänge einen weiteren – indirekten – Beleg, denn Sommer ist im deutschen Sprachraum deutlich der Erste, der eine inhaltlich zusammenhängende Liederfolge (Aufführungsdauer rund 25 Minuten) zu einem Orchesterliedzyklus für Sologesang und symphonisches Orchester umformt. Sommer ließ die Orchesterfassung von Sapphos Gesänge allerdings vermutlich erst um 1903 als Leihmaterial erscheinen.
Die erste öffentliche Erwähnung des Orchesterliedzyklus‘ datiert dagegen vom Januar 1885 (Allgemeine Musik-Zeitung, Berlin). Seine Uraufführung erlebte ein Einzellied daraus 1889 in den Niederlanden, der komplette Zyklus in Braunschweig 1903. Insgesamt liegen von Sommer 29 Orchestergesänge vor (u. a. eine geschlossene Gruppe von 20 Goethe-Liedern, komponiert und orchestriert zwischen 1919 und 1921).
Von den 10 Opern Sommers hatte besonders der 1892/93 in Weimar komponierte Einakter Saint Foix als Erstlingswerk der historisierenden „Konversationsoper“ (UA 1894) trotz zunächst vehementer Ablehnung des Publikums wie der Kritik das Interesse und die Wertschätzung bei Kollegen geweckt, vor allen anderen bei Richard Strauss („modernes Pendant zum Barbier von Sevilla u. Figaros Hochzeit“), mit dem Sommer seit den gemeinsamen Weimarer Jahren (1889–1894) eine anfangs engere, später dann weniger intensive, dennoch lebenslange, von gegenseitigem Respekt geprägte Freundschaft verband.
Hans-Christoph Mauruschat
