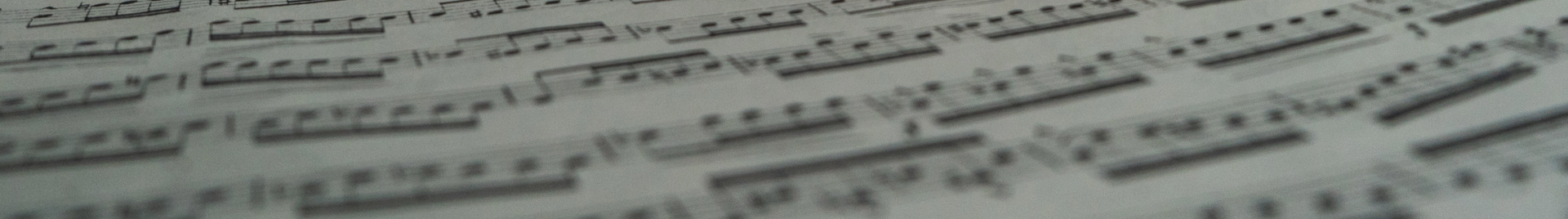

Wilhelm Grosz
*11. August 1894
†10. Dezember 1939
Werke von Wilhelm Grosz
Biographie
geb. Wien/Österreich
gest. New York/USA
Komponist, Dirigent, Pianist
Wilhelm Grosz war musikalisch der Avantgarde zugewandt und musste 1934 durch die Machtübernahme der Nationalsozialisten nach England emigrieren.
R. St. Hoffmann über Wilhelm Grosz in Musikblätter des Anbruch, 4. Jahrgang, Nummer 7-8, 1922:
Geboren in Wien 1894 begann er frühzeitig mit kompositorischen Versuchen noch ohne geregelten Unterricht. Seine Entwicklung ist zweifellos durch das Auftreten des jungen Korngold, der um drei Jahre jünger ist, beeinflusst worden. Der Schneemann war es, der ihn gewiss zu einer Pantomime angeregt hat (1912) und jetzt erst begann ein systematischer Kompositionsunterricht bei Schreker, der bis 1919 dauerte. Gleichzeitig absolvierte der Schüler seine pianistischen Studien bei Professor Robert und frequentierte die Universität, wo er unter Guido Adler zum Doktor der Musikwissenschaft promoviert wurde (1920). Nach einjähriger Kapellmeistertätigkeit in Mannheim lebt er derzeit in Wien seinen Arbeiten, deren jüngste, die Musik zu Werfels Spiegelmensch (Opus 12), demnächst am Burgtheater uraufgeführt werden wird. Die übrigen elf Werke sind mit Ausnahme der letzten drei sämtlich in der Lehrzeit bei Schreker komponiert, aber ganz auffallend wenig von der Eigenart des Lehrers gefärbt, was für dessen Objektivität nicht weniger spricht, als für die selbständige Begabung des Jüngers.
Die Vorliebe für das Klavier entspringt der ganz besonderen pianistischen Begabung des Komponisten, dessen Klaviersatz dem Geist des Instruments in einer Weise gerecht wird, wie sie heute keineswegs alltäglich ist. Dies ist mir schon bei Besprechung seiner Grieg-Variationen im Jahre 1915 aufgefallen, als ich von ihnen schrieb: „… voll Geschick gemacht, voll Sinn für Klaviersatz – heute eine Seltenheit – und überraschend temperamentvoll in einigen der geschwinden Veränderungen. Hier darf man ein gutes Prognostikon stellen.“ Temperament, geistreich-rhythmische Beweglichkeit, das im besten Sinne Amüsante bis zum Übermütig-Grotesken (siehe auch seine Beiträge im Grotesken-Album der Universal Edition) sind denn auch eine bemerkenswerte stilistische Eigenart unseres Autors geblieben. Vielfach fußt er in ganz charakteristischer Weise auf den Tanzrhythmen, dem dreiteiligen Walzertypus, hier weniger originell, mehr französisch-elegant, wenn auch immer voll harmonischer und rhythmischer Pikanterie. Auch andere, ältere Formen interessieren ihn: Menuett, Gavotte und Musette in der Tanzsuite, Musette in den symphonischen Variationen, Tarantella-ähnliche Bildungen wie im zweiten Satz der Violinsonate, im Scherzo des Quartetts im Scherzoteil der symphonischen Variationen, in der Schlußstretta des zweiten der phantastischen Orchesterstücke. Viel wichtiger aber erscheint hier der zweiteilige Rhythmus, so der famos-burleske Hochzeitsmarsch im Spiegelmensch, weniger der etwas Mahlerische Trauermarsch in den symphonischen Variationen als der derbe Polka-Rhythmus ausgesprochen slawischer oder magyarischer Provenienz. Grosz‘ Interesse für solche nationale Eigenart beweist auch sein Sammeln exotischer Volkslieder und seine glänzenden Bearbeitungen ostjüdischer Volkslieder. Sei es die Polka der Tanzsuite, der ironische Foxtrott im Spiegelmensch, der wild-humoristische Tanz des zweiten Orchesterstückes, die zweite Groteske oder die brillanten serbischen, russischen, magyarischen Genrebilder in den Liebesliedern — da ist Grosz‘ Humor in seinem Element. Dass die Erfindungsgabe, die Originalität in Rhythmik und Harmonik, die Laune, die er hierbei entwickelt, ihn für das Ballett und die komische Oper prädestinieren müssen, ist für mich keine Frage. Freilich täte man ihm schweres Unrecht, wenn man über diesen Vorzügen die ernste Seite seines Wesens übersehen wollte. Schon seine Beherrschung schwieriger Formprobleme ist besonders beachtenswert. Der Aufbau des lyrischen ersten Satzes der Violinsonate, das Finale des Streichquartetts und die sehr bedeutenden fünfzehn symphonischen Variationen, die bei strenger thematischer Durchführung des Variationsprinzips einen großen symphonischen Satz bilden, der in sich wieder die Viersätzigkeit deutlich sich sondern lässt – dazu die glänzende kontrapunktische Arbeit, dies alles sind volle Belege für eine früh erworbene hohe Meisterschaft. Und nun zum dritten, noch immer nicht unwichtigsten: auch die Kraft und der Reichtum seiner melodischen Eingebungen erweisen sich allerorten und es sind wieder nur einzelne Stichproben, wenn ich gerade das Adagio der Violinsonate, das entzückende Quartett-Intermezzo, das ernst-bedeutende Thema der symphonischen Variationen und den zum Adagio erweiterten Teil der Veränderungen und endlich manches zart empfundene Lied nenne, wobei ein gewisser Richard Straußscher Überschwang der früheren Zeit in den Rondels zu größerer Ruhe und Intensivierung weiter entwickelt erscheint. Parallel damit geht wohl auch eine größere Beruhigung im Harmonischen und Rhythmischen, wie denn Grosz, ebenso wie der nicht viel jüngere Korngold, bei aller harmonischer Freiheit überzeugter Tonaliker ist (wie liebt er die häufig wiederkehrenden, mit Dominante-Tonika scharf kadenzierenden tonart-markierenden Cäsuren). Eine gewisse entfernte geistige Verwandtschaft besteht zweifellos zwischen diesen beiden – was festzustellen leichter ist, als die Unterschiede sich klarzumachen, umso mehr, als der ältere Grosz als Komponist der jüngere ist und seine Befähigung für die Bühne erst zu beweisen haben wird. (Dass ihm das Orchester bereits untertan ist, zeigt die prächtig klingende Instrumentation der Kammerlieder und der phantastischen Stücke.) Und darum möchte ich mich wieder, wie damals nach dem Opus 1, unbedingt getrauen, auch dieser Zukunftsmusik ein gutes Prognostikon zu stellen.
